Amerikas Progressive und der Supreme Court
Warum der Ruf nach Rückzug ein Irrweg ist
Während der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten in seine Sommerpause geht und die ersten Monate der Auseinandersetzung mit dem „radikalen Konstitutionalismus“ der Trump-Administration hinter sich gebracht hat, ringt die progressive Opposition um die passende Strategie für die nächste Phase des Konflikts. Im Zentrum dieser Debatte stehen oft grundlegende Vorbehalte gegenüber dem Gericht selbst. Viele betrachten dessen konservative Besetzung als illegitimes Ergebnis von Donald Trumps gezielter Einflussnahme auf den Ernennungsprozess, mit dem er eine rechte Mehrheit durchsetzen wollte. Für viele Kritiker*innen gleicht dieser Eingriff einem stillen Staatsstreich, dessen Folgen bis heute spürbar sind: Eine von finanzstarken rechten Kräften beeinflusste Mehrheit auf der Richter*innenbank missachtet Präzedenzfälle und etablierte Argumentationsprinzipien, um eine hyperkonservative Agenda durchzusetzen. Gleichzeitig finden sich die USA in einem constitutional moment wieder, in dem Trump eine radikale MAGA-Agenda vorantreibt – verbunden mit weitreichenden Ansprüchen auf exekutive Autorität, um seine spezifische Spielart rechtsautoritärer Politik durchzusetzen. Das Gericht ist zwangsläufig der Ort, an dem tiefgreifende verfassungsrechtliche Konflikte ausgetragen werden. Progressive sehen deshalb kaum eine Alternative, an die sie sich wenden können. Jahrzehntelang prägte viele progressive Strömungen die Überzeugung, dass der Supreme Court eben genau diese Rolle auch spielen sollte – dass Fragen dieser Tragweite genau dort, vor neun Richter*innen, und nicht in der unübersichtlichen Welt alltäglicher Politik, entschieden gehören.
Genau darin liegt das Dilemma: Progressive erleben die derzeitigen Konflikte vor dem Supreme Court als eine Konstellation, in der es letztlich nichts zu gewinnen gibt. Innerhalb des progressiven Lagers mehren sich Stimmen, die nüchternen Realismus walten lassen und zu strategischer Zurückhaltung mahnen: Progressive sollten sorgfältig abwägen, in welchem Umfang sie gerichtliche Auseinandersetzungen anstoßen, etwa durch die bewusste Auswahl der Fälle, die sie vor den Supreme Court bringen. Oft liegt diese Entscheidung bei ihnen. Denn das Gericht kann sich nicht beliebig einzelne Streitfragen aus dem Dickicht anhängiger Verfahren herauspicken – auch wenn es die ihm vorgelegten Fragen in gewissem Rahmen umformulieren kann. Überall dort, wo Progressive Einfluss darauf haben, welche Fälle den Supreme Court erreichen – etwa durch Rechtsmitteleinlegung gegen Urteile unterer Instanzen – sei Zurückhaltung geboten. Die Zeit sei gekommen, so argumentieren manche Kommentator*innen auch auf diesem Blog, dass Progressive aufhören sollten, sich am Supreme Court die Hörner abzustoßen und stattdessen auf politische Strategien setzen müssen, um sich gegen die Trump-Agenda zu wehren.
Dieser Vorschlag wird der komplexen Haltung des Gerichts gegenüber der Trump-Ära aber nicht gerecht. Die Lage ist vielschichtig, doch zwei Aspekte stechen besonders hervor: Zum einen ist der Roberts Court zwar eindeutig konservativ, aber kein „Trump“-Gericht. Zum anderen variiert sein Konservatismus je nach Fallkonstellation– gerade bei Konflikten um Trumps Streben nach präsidentieller Allmacht könnte sich das Gericht über kurz oder lang als erstaunlich wenig empfänglich für seine Pläne erweisen.
In Trumps erster Amtszeit erfolgten seine Ernennungen überwiegend durch ein Auswahlverfahren, das vom Rechtsberater des Weißen Hauses gesteuert wurde und in enger Abstimmung mit Vertreter*innen der Federalist Society stattfand – einer Organisation, die sich einem „konservativen und libertären“ Verfassungsverständnis verpflichtet sieht, insbesondere dem Grundsatz, dass die Gewaltenteilung im Zentrum der US-Verfassung steht. Die Richter*innen, die aus diesem Prozess hervorgingen, entsprachen diesen Maßstäben der Federalist Society – nicht aber jenen des MAGA-Lagers, das sich vielleicht am treffendsten mit dem Begriff „radikaler Konstitutionalismus“ beschreiben lässt, wie ihn Russell Vought, der Direktor des Office of Management and Budget unter Trump 2.0, geprägt hat. Dieser Begriff beruht auf einem umfassenden Verständnis präsidentieller Macht. Trump selbst ist dieser Unterschied nicht entgangen – und sieht ihn als Verrat. „Ich bin so enttäuscht von der Federalist Society wegen der schlechten Ratschläge, die sie mir bei zahlreichen Richterernennungen gegeben hat“, wetterte er auf Truth Social. „Das ist etwas, das man nicht vergessen kann!“
Gerade wenn es um Trumps Streben nach präsidialer Übermacht und die juristischen Strategien zu deren Durchsetzung geht, könnte das Gericht seiner Agenda die Gefolgschaft verweigern. Tatsächlich lässt sich argumentieren, dass nicht der Präsident, sondern das Gericht gestärkt aus den ersten Gefechten dieses Machtkampfes hervorgeht. Wie Jack Goldsmith schreibt, war der Supreme Court der klare Sieger im jüngsten Fall zur birthright citizenship, in dem es bislang lediglich um die Frage ging, ob untere Gerichte landesweit gültige einstweilige Verfügungen erlassen dürfen. Das Gericht rang dem Solicitor General der Regierung ganz bewusst ein Zugeständnis ab, das es in seiner Entscheidung ausdrücklich festhielt: Die Exekutive werde sich landesweit nicht nur an das konkrete Urteil des Gerichts halten, das nur für die beteiligten Parteien bindend ist, sondern auch an dessen „Rechtsauffassungen“ – was bedeutet, dass sie dessen rechtliche Ausführungen auch in anderen Zusammenhängen befolgen werde.
Ob dieses Zugeständnis langfristig Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Doch es ist ein bemerkenswerter Schritt des Gerichts, den Theoretiker eines „radikalen Konstitutionalismus“ kaum gutheißen dürften. Kritiker*innen des Gerichts entgegnen darauf häufig mit Verweis auf die vielbeachtete Entscheidung in Trump v. United States aus dem vergangenen Jahr zur Immunität früherer Präsidenten vor strafrechtlicher Verfolgung: Wie viel weiter könnte dieses Gericht Trumps Interessen denn noch entgegenkommen?
++++++++++Anzeige++++++++++++
Am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales und Europäisches Privatrecht, Zivilprozessrecht und Rechtsvergleichung der Universität Bremen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (w/m/d) (Entgeltgruppe 13 TV-L mit 50% der wöchentlichen Arbeitszeit, d.h. 19,6 Wstd.) zu besetzen. Wenn Sie sich mit diesen Lehr- und Forschungsgebieten identifizieren können oder sich auch nur allgemein für das Zivilrecht interessieren und ggf. promovieren und auch eigene Lehrerfahrungen sammeln möchten, freut sich Prof. Dr. Rieländer auf Ihre Bewerbung!
++++++++++++++++++++++++++++
Dieses Argument stößt aber an seine Grenzen. Ich teile die Sorge der Kritiker*innen über zentrale Aspekte dieser Entscheidung voll und ganz – vor allem über die Feststellung, dass amtliche Handlungen eines Präsidenten nicht einmal als Beweismittel in einem Strafprozess herangezogen werden dürfen, sofern für das Verhalten keine Immunität beansprucht werden kann. (Ich habe mich ohnehin stets entschieden gegen die Auffassungen der Exekutive ausgesprochen, die Präsidenten während ihrer Amtszeit vollständige Immunität zugestehen). Es war jedoch keineswegs überraschend, dass das Gericht in dogmatischer Hinsicht zu dem Ergebnis kam, dass auch ehemalige Präsidenten einen erheblichen Grad an Immunität genießen. Die (bedauerliche) Logik, mit der Regierungen unterschiedlicher Couleur die vollumfängliche Immunität amtierender Präsidenten verteidigt haben, muss in gewisser Weise auch auf Strafverfolgung Anwendung finden, die erst nach dem Ende der Amtszeit eingeleitet wird. Bemerkenswert ist, dass die Biden-Administration zwar Trumps Anspruch auf absolute Immunität für amtliche Handlungen eines ehemaligen Präsidenten zurückwies, gleichzeitig aber die Auffassung vertrat, dass strafrechtliche Vorschriften auf „zentrale“ präsidentielle Funktionen keine Anwendung finden dürfen. Ungeachtet der unmittelbaren und zu Recht kontroversen Auswirkungen auf die strafrechtliche Verfolgung Trumps im Zusammenhang mit dem 6. Januar war die dem Gericht vorliegende verfassungsrechtliche Frage also komplex – und in wesentlichen Punkten bleibt unklar, wie sie künftig auf die Immunisierung rechtswidrigen präsidentiellen Handelns angewendet werden wird.
Weder in dieser Entscheidung noch in anderen Fällen, in denen die Regierung in der letzten Sitzungsperiode obsiegt hat, sehe ich klare Hinweise darauf, wie das Gericht letztlich über die Verfassungsmäßigkeit der Executive Order zur Geburtsortsstaatsbürgerschaft oder über Trumps Berufung auf den Alien Enemies Act zur Rechtfertigung seiner Abschiebungsbefugnis entscheiden wird. Im Fall der Abschiebung venezolanischer Staatsangehöriger mit angeblichen Verbindungen zu Drogenkartellen hat das Gericht auf rechtsstaatliche Verfahren und eine angemessene Vorankündigung bestanden. Es untersagte die Abschiebung einer Gruppe Inhaftierter nach dem Alien Enemies Act, solange das Berufungsverfahren noch anhängig ist – nachdem es bereits einen Monat zuvor in den frühen Morgenstunden einen vorläufigen Abschiebestopp verhängt hatte. Außerdem bestätigte es die Anordnung eines untergeordneten Gerichts, wonach die Regierung die Rückführung einer Person ermöglichen muss, deren Abschiebung sie selbst als Fehler eingeräumt hatte. In diesen Fragen – wenn auch nicht in allen – hat das Gericht deutlich gemacht, dass es sich nicht nur genau ansehen wird, was die Regierung behauptet, sondern auch das, was sie tatsächlich tut. Bislang ist auch keineswegs klar, ob das Gericht bereit ist, Trumps Forderungen und den Vorstellungen seiner radikalen Verfassungstheoretiker*innen zu folgen, wenn es um die Kontrolle unabhängiger Behörden geht. In einer vorläufigen Anordnung zeigte es sich bereits zurückhaltend hinsichtlich einer weitreichenden präsidentiellen Entlassungsbefugnis gegenüber der Federal Reserve. Ähnliche Bedenken könnten das Gericht davon abhalten, Präsidenten die volle Kontrolle über politisch besonders sensible Behörden wie die Federal Election Commission (zuständig für Wahlkampffinanzierung) oder die Election Assistance Commission (zuständig für die Organisation von Wahlen) zu übertragen, die der Kongress bewusst so ausgestaltet hat, dass keine politische Partei allein über deren Arbeit bestimmen kann.
Es wird noch – womöglich viel – Zeit ins Land gehen, bevor sich diese Debatte über die Rolle des Gerichts in die eine oder andere Richtung abzeichnet. Die Zeichen sind alles andere als nur positiv. Die Anordnungen des Gerichts, mit denen einstweilige Verfügungen unterer Instanzen gegen Massenentlassungen im Bildungsministerium sowie gegen die Umsetzung einer Executive Order zur drastischen Stellenkürzung in der Exekutive ausgesetzt wurden, sind besorgniserregend. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus. Die Richter*innen sind mit einer Vielzahl von Fällen überlastet und entscheiden immer öfter im Eilverfahren. In einigen dieser Prozesse könnte das Gericht bereits erahnen lassen, in welche Richtung es sich bewegt – falls, oder vielmehr wenn, es die Berufung gegen die Entscheidungen der Vorinstanzen zur umfassenden Prüfung zulässt. In anderen Fällen ist eine solche Tendenz kaum erkennbar. Die Herausforderungen, denen das Gericht derzeit gegenübersteht, sind – um ein überstrapaziertes, hier aber treffendes Wort zu verwenden – beispiellos. Entsprechend dünn ist die Grundlage für verlässliche Prognosen über die endgültigen Entscheidungen.
Was sich mit größerer Sicherheit sagen lässt: In vielen verfassungsrechtlichen Fragen, die Progressiven am Herzen liegen – etwa beim Schutz von LGBTQ-Rechten, reproduktiven Rechten oder in der Trennung von Staat und Religion – wird die Mehrheit des Gerichts konservativ entscheiden. Genau auf diesen vielgestaltigen Konservatismus haben Republikaner*innen gemeinsam mit der Federalist Society und einem republikanisch dominierten Senat hingearbeitet – und genau den haben sie bekommen. Realistische Erwartungen und eine kluge Auswahl gerichtlicher Verfahren sind daher absolut sinnvoll. Doch wenn es um die Abwehr der grundlegenden Gesetzesfeindlichkeit dieser Regierung geht, die ihr Verständnis präsidentieller Macht auf eine „radikal-konstitutionalistische“ Grundlage stellt, wird das Gericht zwangsläufig eine zentrale Rolle spielen. Und: Es gibt bislang keinerlei Anzeichen dafür, dass es durchweg als verlässlicher Verbündeter dieses Präsidenten entscheiden wird.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Spotlight: US Democracy Under Threat
The US is facing a deep constitutional crisis.
Keeping up with recent developments isn’t always easy.
Our Spotlight Section, “US Democracy Under Threat,” brings together insights from leading legal scholars.
Open access, timely, and read by a global audience.
++++++++++++++++++++++++++++
Es gibt einen entscheidenden, wenn auch zunächst naheliegenden Grund, warum Progressive den Dialog mit dem Gericht nicht scheuen sollten: Die Verteidigung gegen präsidentiellen Suprematismus und die progressive Sorge an der inhaltlichen Entwicklung des Verfassungsrechts lassen sich nicht voneinander trennen. Exekutiven, die durch Executive Orders und Notverordnungen regieren, gelingt es – und sie bemühen sich gezielt darum –, ihre verfassungsrechtlichen Ziele um- und durchzusetzen, ohne dabei allzu große Rücksicht auf die Gerichte nehmen zu müssen. In einem System, das weniger durch eine Trennung der Gewalten als durch eine Trennung der Parteien bestimmt ist, hat sich gezeigt, dass der Kongress kaum in der Lage ist, der Exekutive wirksam Schranken zu setzen. Wenn Progressive also über die Anrufung der Gerichte nachdenken, stehen sie nicht vor der Wahl zwischen verfassungsrechtlichen Fragen präsidentieller Macht und allen anderen Anliegen. Ihre grundlegenden Überzeugungen hängen entscheidend davon ab, ob es gelingt, eine präsidentielle Vorherrschaft einzudämmen, die politische Programme vorantreibt, die sie entschieden ablehnen. Es sei denn, jemand käme auf die Idee, die Demokrat*innen könnten dieses Modell der präsidentiellen Allmacht übernehmen, wenn sie das nächste Mal ins Weiße Haus einziehen. Ein Gedanke, den man besser ganz schnell wieder verwirft.
Was das Argument betrifft, Progressive sollten ihre Erwartungen eher auf politische Strategien richten – auf den Kampf um Wahlen und die öffentliche Meinung – statt auf die Gerichte: Ja, unbedingt. Und das nicht nur aus Enttäuschung über den heutigen Supreme Court, sondern grundsätzlich – und zu jeder Zeit.
*
Editor’s Pick
von TILL STADTBÄUMER
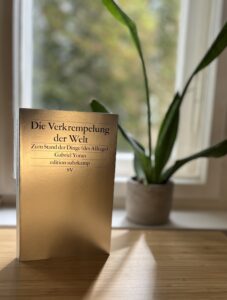
Foto: Eigene Aufnahme
Kennen Sie dieses diffuse Gefühl, dass die Dinge des Alltags immer schlechter werden? Elektroprodukte werden zwar effizienter und sparsamer, haben nun aber einen Touchscreen statt Knöpfe, alles hat eine eigene App, die Geräte kämpfen unaufhörlich um unsere Aufmerksamkeit (denken Sie nur an den Kaffee-Vollautomaten, der ständig um seine Reinigung bittet). Diese Gleichzeitigkeit von Fort- und Rückschritt beschreibt Gabriel Yoran in „Die Verkrempelung der Welt“. Dabei geht es um mehr als um die Feststellung, dass „früher alles besser“ war. Es geht um die Frage, warum die Dinge des Alltags nicht mehr so gut sind, wie sie sein könnten, was ein „gutes“ Produkt und Nachhaltigkeit eigentlich ausmacht und warum wir kaufen, was wir kaufen. Ein tolles Buch – ganz ohne zugehörige App und krempelfrei.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von CHARLOTTE HERBERT
Ein politisiertes Verfassungsgericht und harte Kämpfe um richterliche Neuernennungen. Was wir aus den Vereinigten Staaten schon länger kennen, schien der deutschen Verfassungskultur überwiegend fremd zu sein. Wie schnell und drastisch sich die Dinge ändern können, zeigen die Vorgänge rund um die gescheiterte Wahl dreier Richter*innen an das Bundesverfassungsgericht. Im Fokus steht dabei Frauke Brosius-Gersdorf, eine Professorin für Öffentliches Recht, die bislang nicht den Ruf hatte, politisch besonders weit links zu stehen. Einen geänderten Wikipedia-Eintrag und eine beispiellose Kampagne später sah sich Brosius-Gersdorf zahlreichen Angriffen auf ihre Person und ihr wissenschaftliches Werk ausgesetzt.
Dass diese Angriffe nicht nur zu weit gehen, sondern auch geeignet sind, die demokratische Ordnung zu beschädigen, haben diese Woche bei uns über 300 Rechtswissenschaftler*innen in einer viel beachteten Stellungnahme ausgeführt.
Für „irrlichternd“ hält auch KLAUS FERDINAND GÄRDITZ (DE) den Umgang mit Frauke Brosius-Gersdorf, der als kumuliertes Anschauungsmaterial dafür diene, wie Richterwahlen nicht ablaufen sollten.
Auch VICTOR LOXEN (DE) hat sich mit der Debatte rund um Brosius-Gersdorf beschäftigt und sich dabei die zentrale Rolle der Menschenwürde angeschaut. Dass der Diskurs so entglitten ist, sei mit Blick auf das deutsche Verständnis der Menschenwürde als „Wert“ kein Zufall.
Auf europäischer Ebene wurde in der Rechtssache Ukraine und Niederlande gegen Russland vergangene Woche wohl eines der wichtigsten Urteile in der Geschichte des EGMR gefällt, meint ISABELLA RISINI (EN). Russland wird darin für den Abschuss von Flug MH17 und zahlreiche systematische Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine verantwortlich gemacht. Insbesondere die Feststellungen des EGMR zum Verhältnis von humanitärem Völkerrecht und Menschenrechten seien bahnbrechend.
Ein weiteres bahnbrechendes Urteil des EGMR gab es im Bereich des Sportrechts. Im Fall Caster Semenya verurteilte das Gericht die Schweiz wegen Verstößen gegen das Recht auf ein faires Verfahren. Ein deutliches Signal an das schweizerische Bundesgericht und den internationalen Sportschiedsgerichtshof (CAS), meint ANTOINE DUVAL (EN).
Ein weiteres Urteil des EGMR hat TILMAN HOPPE (EN) eingeordnet: Amtsträger*innen, die unerklärlichen Reichtum anhäufen, hätten demnach mit der Einziehung ihres Vermögens zu rechnen – auch ohne konkreten Straftatnachweis.
Nicht nur innerhalb Europas, sondern auch in den europäischen Außenbeziehungen standen diese Woche weitere rechtliche Fragen im Fokus. Beim Treffen der EU-Außenminister*innen Ende Juni blieb eine Einigung über die Zukunft des Assoziierungsabkommens mit Israel (AA EU–Israel) aus. ANŽE MEDIŽEVEC (DE) verweist auf das Westsahara-Urteil des EuGH aus dem Jahr 2024, das die völkerrechtlichen Verpflichtungen der EU betone und damit nahelege, dass das Abkommen mit Israel ausgesetzt werden müsse.
Auch der High Court in London befasste sich mit Israel. Er entschied, dass das Vereinigte Königreich weiterhin Lizenzen für Bauteile des F-35-Kampfjets ausstellen dürfe – auch wenn diese über ein Ersatzteillager nach Israel gelangen könnten. GALINA CORNELISSE (EN) sieht offene Fragen zur Vereinbarkeit britischer Rüstungsexporte mit dem Waffenhandelsvertrag und anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen.
++++++++++Anzeige++++++++++++
An der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien ist eine Universitätsprofessur für Rechtsethik und Rechtsphilosophie zu besetzen. Bewerber*innen sollen über ausgezeichnete akademische Qualifikationen in der Rechtsphilosophie und im Recht der Europäischen Union sowie in den Überschneidungsbereichen dieser beiden Fächer verfügen. Erwünscht sind gleichwertige Ausweise in Rechtsphilosophie und Europarecht und die damit verbundene Befähigung, beide Fächer vollumfänglich in Forschung und Lehre zu vertreten. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
Die Bewerbungsfrist läuft bis 17. September 2025.
++++++++++++++++++++++++++++
Problematische verfassungsrechtliche Entwicklungen lassen sich derzeit in Kolumbien beobachten: Mitte Juni setzte Präsident Petro per Dekret eine nationale Volksbefragung zu sozialen Reformen an – nachdem der Senat diese abgelehnt hatte. VICENTE F. BENÍTEZ-R. und FABIO ENRIQUE PULIDO ORTIZ (EN) sehen darin eine Wende hin zu einem zunehmend schmittianischen Machtverständnis.
Einen tiefgreifenden Umbruch erlebe aktuell auch die Türkei. Getragen werde er jedoch von alten Männern, meint DORUK ERHAN (EN). Er warnt: Diejenigen, die tatsächlich für einen Generationenwechsel stünden, würden weiter zum Schweigen gebracht.
Wie lernfähig autoritäre Regierungen sein können, zeigt PETER ČUROŠ (EN) am Beispiel der Slowakei: Dort könnte ausgerechnet die juristisch fundierte Kritik von NGOs an einem Gesetzesentwurf zur Registrierung ausländischer Agenten (Foreign Agents Registration Bill) dessen Chancen vor Gericht unbeabsichtigt erhöhen – und seine Umsetzung damit sogar begünstigen.
Ende Juni erklärte der spanische Verfassungsgerichtshof das katalanische Amnestiegesetz für verfassungsgemäß. JOSEP M. TIRAPU-SANUY (EN) analysiert die Entscheidung und sieht darin weniger ein Prinzipienurteil als eine pragmatische Lösung.
In Dänemark erging Mitte Juni ein wegweisendes Urteil des Obersten Gerichtshofs zum Grundsatz der Nichtbestrafung von Geflüchteten, der in Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention verankert ist. ASTA S. STAGE JARLNER und SARAH SCOTT FORD (EN) begrüßen zwar das Ende einer langjährigen rechtswidrigen Praxis, kritisieren aber die unzureichende Aufklärung Betroffener über ihre Rechte.
Im digitalen Raum hat die Europäische Kommission vergangene Woche die finale Version ihres Verhaltenskodex für KI für allgemeine Zwecke (GPAI) veröffentlicht. GUSTAVO GIL GASIOLA (EN) analysiert, ob das der richtige Weg zu einer effektiven Regulierung von solchen KI-Modellen ist.
Auch im Bereich KI und Urheberrecht ist viel in Bewegung. Der EuGH erhielt Ende Mai seine erste Vorlage zu Chatbots und Urheberrecht. PHILIPP HACKER (DE) untersucht den Fall, skizziert mögliche Antworten und meint: Der Fall könne die Zukunft der KI-Entwicklung maßgeblich verändern.
Wenig überzeugt zeigen sich JAN-OLE HARFST, TOBIAS MAST und WOLFGANG SCHULZ (EN) mit Blick auf die Durchsetzung des Digital Services Act. Die jüngsten EU-US-Handelsgespräche ließen befürchten, dass die Kommission zentrale Durchsetzungsaufgaben vernachlässige. Ihre Forderung: Die Rolle der Kommission bei der Durchsetzung zu überdenken.
Wie weit die Kontrolle von Unternehmen über kritische Infrastrukturen gehen dürfe, fragt ALINA UTRATA (EN). Sie meint: Die Abhängigkeit von Starlink und Cloud-Anbietern lege die politische Macht von Konzernen offen – diese seien daher wie Staaten als politische Akteure zu behandeln.
Wir haben diese Woche außerdem das Symposium „Human Rights Protection in the Climate Emergency: The Inter-American Court of Human Rights’ Advisory Opinion No. 32“ (EN) fortgesetzt:
DAVID R. BOYD (EN), ehemaliger UN-Sonderberichterstatter, beleuchtet das Recht auf eine saubere Umwelt. MARKUS GEHRING (EN) hält insbesondere die Aussagen des Gerichts zu Jus Cogens für wegweisend. MARIA ANTONIA TIGRE, DINA LUPIN und NATALIA URZOLA GUTIÉRREZ (EN) betonen den besonderen Fokus des Gutachtens auf geschlechtsspezifische Aspekte der Klimakrise.
Schließlich ging unser Symposium zu Animal Rights: The Role of the EU Charter (EN) mit einem Text von ESTER HERLIN-KARNELL (EN) zu Ende. Sie sieht Reformbedarf bei den stark variierenden Tierarztkosten in Europa – im Sinne von Grundrechten und Nachhaltigkeit.
So endet auch diese Woche. Nach dem Wochenende soll es sich in Deutschland etwas abkühlen. Das können wir gut gebrauchen, nicht nur mit Blick auf das Wetter.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.








