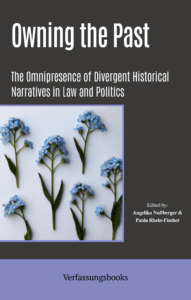Doppelfolge der „Double Standards“
Erosion und Stärkung des Völkerrechts zugleich
Der Sommer ließ zwar Parlamentssitzungen, Vorlesungen und das Editorial des Verfassungsblogs ruhen, nicht aber das Völkerrecht. Anfang September hat der Shanghai-Gipfel die fortlaufende Erosion der sogenannten liberalen Völkerrechtsordnung und die drohende Spaltung dieser Ordnung augenfällig gemacht. Die Führer der versammelten asiatischen Staaten (meist Autokratien) haben wieder einmal die „double standards“ des Westens (Nordens) beklagt (Tianjin Declaration v. 1. Sept. 2025).
Der Vorwurf der double standards ist nicht neu, hat aber in der Phase des Umbruchs der Weltordnung, in der wir uns befinden, eine ganz neue Dynamik und Brisanz gewonnen. Er betrifft insbesondere die angeblich selektive Durchsetzung des Völkerrechts durch Staaten des Westens gegenüber den schwächeren Staaten des globalen Südens. Dieser Vorwurf leuchtet intuitiv ein. Denn wohl jede (Rechts-)kultur der Welt kennt als Grundprinzip der Fairness und Gerechtigkeit, dass „Gleiches“ auch „gleich“ behandelt werden soll, und „Ungleiches“ „ungleich“, wenn keine sachlichen Gründe für eine Abweichung bestehen. Ob aber double standards bloß behauptet werden oder ob tatsächlich eine ungerechtfertigte Praxis vorliegt, kann meist nur eine genauere Prüfung der Tatsachen und Rechtslage zeigen.
Insbesondere muss die strukturelle Besonderheit des Völkerrechts als dezentrale Ordnung unter Gleichen und ohne Gewaltmonopol beachtet werden. Die Staaten sind in ihren „horizontalen“ Verhältnissen untereinander, sofern nichts Besonderes geregelt ist, gerade nicht zur Gleichbehandlung verpflichtet. Der Grundsatz der souveränen Gleichheit verbietet beispielsweise nicht, dass Deutschland seine (Entwicklungs-)gelder an und Handelsbeziehungen mit Syrien an Bedingungen knüpft (etwa Schulbildung für Mädchen), die es Saudi-Arabien oder der Türkei nicht auferlegt, da die letzteren Staaten sind, die Deutschland aus geostrategischen Interessen an sich binden will.
++++++++++Anzeige++++++++++++
HUMANISTISCH. NACHHALTIG. HANDLUNGSORIENTIERT.
Die Leuphana Universität Lüneburg steht für Innovation in Bildung und Wissenschaft. Methodische Vielfalt, interdisziplinäre Zusammenarbeit, transdisziplinäre Kooperationen mit der Praxis und eine insgesamt dynamische Entwicklung prägen ihr Forschungsprofil in den Themen Bildung, Kultur, Management & Technologie, Nachhaltigkeit sowie Staat. Ihr Studienmodell mit dem Leuphana College, der Leuphana Graduate School und der Leuphana Professional School ist vielfach ausgezeichnet.
An der Leuphana Universität Lüneburg ist die folgende Juniorprofessur zu besetzen:
– öffentliches recht (W1)
NEUGIERIG GEWORDEN? Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie hier.
++++++++++++++++++++++++++++
Auch sind nur in seltenen Konfliktfällen internationale Gerichte oder Gremien zuständig, um verbindlich die Tatsachen und die Rechtslage festzustellen. Ob Situationen eine gleiche Behandlung verdienen oder nicht, ist deshalb oft eine Ansichtssache, solange die autoritative Schließung ausbleibt. Des Weiteren bieten völkerrechtliche Institutionen den schwachen Akteuren nur einen geringen Schutz gegen Übergriffe, vor allem nicht gegen ein Ständiges Sicherheitsratsmitglied wie Russland oder die USA, die jegliches Eingreifen des Sicherheitsrats mit ihrem Veto verhindern können. Da sie nicht durch eine mächtige Institution geschützt werden, ist es aus vielen Gründen für die meisten Staaten klug, Worten (z.B. UN GA Res. ES-11/L.1 v. 1. März 2022) gerade keine Taten (etwa Sanktionen gegen Russland) folgen zu lassen.
Schließlich gibt es keine allgemeine Rüge- oder gar Sanktionspflicht. Anders sieht es nur aus, wenn ein konkretes Rechtsregime zu Reaktionen verpflichtet. So ist etwa der UN-Menschenrechtsrat kraft Mandat dazu verpflichtet, Menschenrechtsfragen innerhalb seiner Kapazitätsgrenzen gleichmäßig zu behandeln. Deshalb ist es problematisch, dass er seit seiner Gründung im Jahr 2006 Israel 108-mal „verurteilt“ hat, Russland aber nur achtmal. Auch verpflichtet z.B. Art. 5 des NATO-Vertrages alle Vertragsparteien im Falle eines bewaffneten Angriffs auf eine von ihnen, dieser die „notwendige“ Unterstützung zu leisten.
Da in Abwesenheit solcher und ähnlicher Reaktionspflichten kein Staat zu Sanktionen gegen Rechtsbrecher verpflichtet ist, reagieren die Staaten typischerweise interessengeleitet und damit selektiv. Insbesondere können es sich die starken Akteure erlauben, Regelverletzungen der schwächeren Akteure zu sanktionieren. Man mag dies als Politisierung oder gar Instrumentalisierung des Völkerrechts für die eigenen Interessen beklagen. Die Möglichkeit eines solchen „lawfare“ ist jedoch in die Struktur des Völkerrechts als dezentrale und stark machtabhängige Ordnung eingeschrieben.
Selbst wenn wir eine völkerrechtliche Pflicht zur „horizontalen“ Gleichbehandlung im zwischenstaatlichen Verhältnis annähmen – etwa analog zum Verbot der Diskriminierung durch die Staatsgewalt – würde diese keine schematisch identische Behandlung aller Staaten durch andere erfordern. Denn in zahlreichen Fällen bestehen tatsächliche und/oder rechtliche Unterschiede, die es rechtfertigen oder sogar gebieten, die Situationen unterschiedlich zu behandeln.
Juristen und und Juristinnen könnten diese rechtsrelevanten Unterschiede herausarbeiten, wobei viele Wertungsfragen hineinspielen. Und anders als im Anwendungsbereich des menschenrechtlichen Gleichheitssatzes und der Diskriminierungsverbote ist für ein zwischenstaatliches Verbot der double standards noch weitgehend unklar, welche Kriterien eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen können: Schwere der Rechtsverletzung, Rechtsgebiet, Folgenabschätzung, Kapazitäts- und Machbarkeitsgrenzen, Vorzugsbehandlung von Entwicklungsländern, sonstige legitime Interessen?
++++++++++Anzeige++++++++++++
Discover our latest Verfassungsbook: “Owning the Past: The Omnipresence of Divergent Historical Narratives in Law and Politics”, edited by Angelika Nußberger & Paula Rhein-Fischer.
“‘Owning the Past’ is a rich and concise interdisciplinary and international study that offers a clear orientation and is destined to become an indispensable tool for theoreticians and practitioners involved in the ongoing political struggle over memory in the context of liberal and illiberal politics.”
– Aleida Assmann, University of Konstanz
Now available as soft copy (open access) and in print!
++++++++++++++++++++++++++++
Im Ergebnis ist das aktuelle Anschwellen der meist strategisch und oft missbräuchlich vorgebrachten Litanei der double standards durchaus ambivalent. Theoretisch könnten die juristischen Feinheiten den globalen Öffentlichkeiten erklärt werden. Nicht alle Erwägungen sind jedoch leicht nachvollziehbar. Es bleibt oft der Anschein von double standards haften. Dieser böse Schein stellt ein echtes Problem dar, wenn es um die öffentliche Glaubwürdigkeit geht. Deshalb verbieten Prozessregeln typischerweise den bloßen Anschein von Befangenheit oder Interessenkonflikten. Schon die verbreitete – wenn auch diffuse – Wahrnehmung, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, erschüttert das Vertrauen in das Völkerrecht massiv. Auch befördert der stets drohende Vorwurf der double standards das Duckmäusertum. Um die Schelte gar nicht erst aufkommen zu lassen, halten sich Staaten lieber bedeckt: ein chilling effect für die Benennung von Völkerrechtsverstößen anderer, der die Entwicklung von Völkergewohnheitsrecht bremst.
Andererseits kann der Hinweis auf double standards echte Probleme aufdecken. Es würde das Völkerrecht stärken, wenn sich die westlichen Akteure auf inhaltliche Debatten darüber einließen, welche Situationen vergleichbar und welche möglichen Unterscheidungskriterien legitim sind. Solche Debatten müssten dann auch zur Tiefenschicht des allgegenwärtigen Lamentos vordringen: Denn den Staaten, welche die westliche Doppelmoral beklagen, missfällt es nicht nur, selektiv kritisiert zu werden. Sie wollen am liebsten gar nicht kritisiert werden. Hinter dem Vorwurf der double standards des Westens verbirgt sich häufig nicht die Forderung, das Völkerrecht gleichmäßig durchzusetzen – sondern es gar nicht durchzusetzen. Das Völkerrecht wird als Instrument des Westens gesehen, um westliche Vorherrschaft abzusichern. Deshalb sollten die Staaten des Westens das in dem double standards-Vorwurf liegende Unbehagen an der geltenden Völkerrechtsordnung viel ernster nehmen als bisher und offen sein für inhaltliche Reform.
Vor allem sollte die Chance der Bumerangwirkung genutzt werden: Wer double standards beklagt, signalisiert damit, dass er die Kohärenz der Völkerechtsordnung und die Folgerichtigkeit der Rechtsanwendung für ein wichtiges Gut hält. Der Sprecher fordert damit implizit ein allgemeines Gleichbehandlungsgebot, das im aktuellen Völkerrecht erst im Ansatz angelegt ist. Die Zunahme des Vorwurfs kann somit als Anzeichen gedeutet werden, dass die normativen Erwartungen an das Völkerrecht – in Bezug auf Gleichbehandlung und Fairness – zunehmen.
Der Hinweis auf (echte oder vermeintliche) double standards beinhaltet also auch eine unterschwellige Botschaft, die zu begrüßen ist: die Forderung, auf eine internationale rule of law hinzuarbeiten. Die schlüssige und folgerichtige Rechtsanwendung und -durchsetzung erweist sich so als eine universelle, nicht nur „westliche“ regulative Idee. An dieser Idee sollten die Staaten des Westens, denen double standards vorgeworfen werden, sich orientieren, und sie können die Kritiker ebenfalls daran messen.
*
Editor’s Pick
von EVA MARIA BREDLER
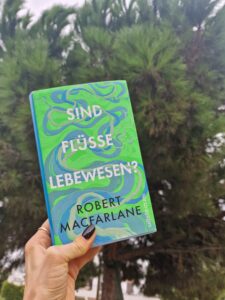
Foto: Eva Maria Bredler
„Rechte der Natur“ werden zwar immer populärer, wirken aber oft abstrakt – ein intellektuelles Gedankenspiel, gar ein Luxus angesichts all der Gewalt um uns herum. Robert Macfarlanes „Sind Flüsse Lebewesen?“ macht diese Abstraktion greifbar, so weit es Sprache erlaubt. Er lässt uns das Lied des ecuadorianischen Nebelwalds Los Cedros und seines Flusses hören, das Gift in den Wasseradern Chennais schmecken und den Schmerz des Mutehekau Shipu im kanadischen Nitassinan spüren. Nebenbei stellt er uns die Menschen vor, die ihr Leben dem rechtlichen Schutz des Lebens widmen – den Professor und Anwalt César Rodriguez-Garavito, die Inuit-Schriftstellerin und Aktivistin Rita Mestokosho und viele andere. Die Antwort auf die titelgebende Frage ist zwar von Anfang an klar, doch am Ende habe ich sie körperlich gespürt. Es mag geholfen haben, dass es zu regnen anfing, als ich das Buch im Park zu Ende las.
*
Der Sommer auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
Die Tage werden kürzer, die Bäume gelber, und Sie haben wieder eine E-Mail von uns im Postfach: Der Sommer ist also vorbei – please don’t shoot the messenger – und wir blicken schon jetzt nostalgisch zurück, mit den zehn meistgelesenen Beiträgen des Sommers (nach Themen, nicht nach Klicks sortiert).
Hoffentlich haben Sie ihn abwechslungsreich verbracht, zum Beispiel mit einer Reise nach Frankreich oder – eine günstige Alternative – mit stundenlangem Tour-de-France-Gucken auf dem Sofa (mein persönliches Sporthighlight des Jahres). Am 13. September geht nun die Leichtathletik-WM los. Davor haben zwei globale Sportverbände – World Athletics und World Boxing – beschlossen, Gentests einzuführen – als Voraussetzung, um in der Kategorie der Frauen antreten zu dürfen. Ziel ist es, bestimmte Frauen – darunter auch solche mit angeborenen „differences of sex development“ – vom Frauensport auszuschließen, ein schon in den 1990ern als unwissenschaftlich, unethisch und letztlich unpraktikabel verworfenes Modell. SONJA ERIKAINEN, KATRINA KARKAZIS, MICHELE KRECH (EN) beschreiben die zahlreichen rechtlichen Fallstricke.
Vielleicht haben Sie den Sommer über nicht nur Sport geschaut (oder gemacht), sondern auch den Bücherstapel kleiner gelesen. Sollten Sie nun statt Mann oder Márquez lieber Marx in Ihrem Lesekreis besprechen wollen, ist allerdings Vorsicht geboten: Das Verwaltungsgericht Hamburg hat kürzlich festgestellt, dass „die von Marx begründete Gesellschaftstheorie“ in wesentlichen Punkten mit den „Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar“ sei. BRUNO LEIPOLD (DE) hat das Urteil für Sie gelesen und besprochen (ganz ohne Zirkel).
Wer neben Marx sonst noch so Verfassungsfeind ist, könnte bald klarer werden: In mehreren Bundesländern steht eine Reform der Verfassungsschutzgesetze an – für JAKOB HOHNERLEIN (DE) eine Chance, die Definition der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ zu modernisieren. Er zeigt, worin sich die Reformansätze der Länder unterscheiden, und schlägt vor, die Legaldefinitionen enger an den Kernelementen Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auszurichten.
Inzwischen erwähnt auch das Stiftungsfinanzierungsgesetz die „Verfassungsfeindlichkeit“, nämlich als potenzielles Ausschlusskriterium der Förderung. Das sind schlechte Nachrichten für die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung: Diese hat für das Haushaltsjahr 2026 beim Bundesinnenministerium einen Antrag in Millionenhöhe gestellt. Doch auch wenn verfassungsrechtliche Zweifel bleiben, dürfte dieser Antrag nun keinen Erfolg haben, prognostiziert ANTJE NEELEN (DE).
Über Erfolg und Scheitern eines anderen Antrags wird nach wie vor gerungen, nämlich den eines AfD-Verbotsverfahrens. SPD-Chefin Bärbel Bas will das Gesprächsangebot der Grünen nun annehmen, auch die Linken signalisieren Zustimmung. Damit könnte Bewegung in die seit Monaten kontrovers geführte Debatte kommen. Dabei werden immer wieder Argumente vorgebracht, die zwar rechtliche Autorität in Anspruch nehmen, verfassungsrechtlich aber nicht haltbar sind. MARKUS OGOREK (DE) klärt über die 10 häufigsten Irrtümer auf.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Der Postmigrantische Jurist*innenbund e.V. sucht nach Mentor*innen für sein Mentoringprogramm ab Wintersemester 25/26.
Das Mentoringprogramm soll den (post)migrantischen juristischen Nachwuchs mit erfahrenen (post)migrantischen Jurist*innen für einen fachlichen und persönlichen Austausch zusammengebringen.
Weitere Informationen zum Mentoringprogramm erhalten Sie hier.
++++++++++++++++++++++++++++
Zwar gibt es auf EU-Ebene keine Verbotsverfahren gegen Gegner europäischer Verfassungsprinzipien, dafür aber kreative Vorschläge zum Umgang mit autoritär-populistischen Mitgliedstaaten, deren Sympathien mit Russland zur handfesten Bedrohung für die EU werden könnten. ARMIN VON BOGDANDY und LUKE DIMITRIOS SPIEKER (EN) machten im Juni einen Vorschlag, wie sich ein ungarisches Veto gegen EU-Sanktionen gegen Russland überwinden ließe. Das brachte den Autoren scharfe Kritik von MARK DAWSON und MARTIJN VAN DEN BRINK (EN) ein, die den Vorschlag dogmatisch nicht überzeugend und politisch gefährlich finden. Wenig überzeugt von dieser Kritik zeigen sich dagegen ARMIN VON BOGDANDY und LUKE DIMITRIOS SPIEKER (EN) in ihrer Replik.
Vor der Sommerpause hat uns die gescheiterte Wahl der Bundesverfassungsrichter*innen intensiv beschäftigt, die der Bundestag nun am 26. September nachholen will. Vor allem der öffentliche Umgang mit der Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf war besorgniserregend. Warum die vielfach formulierten Einwände gegen ihre Kandidatur nicht überzeugen und politisch denkende Verfassungsrichter*innen kein Problem sind, zeigt CHRISTINE LANDFRIED (DE). Kritisch gegenüber dem Ton der Debatte, aber auch gegenüber einigen der Positionen Brosius-Gersdorfs, zeigt sich PATRICK HEINEMANN (DE) und meint: Die Erklärung, die Frauke Brosius-Gersdorf nach dem Verzicht auf ihre Kandidatur veröffentlichte, beklagt zwar völlig zu Recht die Diffamierungen und Schmähungen, wirft in einigen Teile aber auch Fragen auf.
Über öffentliche Erklärungen und Diffamierungen haben auch VICTOR LOXEN und TRISTAN WISSGOTT (DE) nachgedacht. Anlass war Sebastian Hotz alias „El Hotzo“, der bei X zum Attentat auf Donald Trump kommentiert hatte, er finde es „absolut fantastisch“, wenn Faschisten stürben. Zwar hat ihn das Amtsgericht Berlin-Tiergarten vom Vorwurf der Billigung von Straftaten freigesprochen. Für die Autoren wirft der Fall neben der strafrechtlichen allerdings noch eine andere Frage auf: Kann das deutsche Strafrecht überhaupt die Billigung einer Tat erfassen, die mangels einschlägiger Vorschrift aus dem Strafanwendungsrecht nicht hier nicht strafbar ist?
Unterdessen macht der totgesagte Trump business as usual und drangsaliert den demokratischen Verfassungsstaat, auch die Universitäten, nach Art des Business Man: nämlich mit Deals, die jegliche Gesetzgebungsverfahren umgehen – was David Pozen von der Columbia University als „regulation by deal“ bezeichnet. Columbia hat sich so mit der Trump-Regierung über Vorwürfe geeinigt, gegen Bundesgesetze zum Diskriminierungsschutz verstoßen zu haben. Doch wer sich einmal auf einen Business Man (und Bully) einlässt, wird schnell mit neuen Forderungen konfrontiert sein. KIM LANE SCHEPPELE (EN) erklärt die Macht des Bullys und was sie für die Zukunft der US-Universitäten bedeutet.
Wer nach der Sommerpause also etwas träge und lustlos an die Universitäten zurückkehrt – egal auf welcher Seite des Hörsaals – sollte sich daran erinnern: Was für eine Errungenschaft, dort frei studieren und lernen, forschen und lehren zu können. Und was für ein Glück, dass wir die dort keimenden und fermentierenden Ideen hier bei uns frei veröffentlichen können.
Eigentlich schön, dass der Herbst da ist.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.