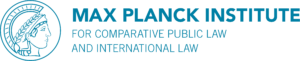Diese Wissenschaftspublikation ist für Sie kostenlos
Warum wissenschaftliche Bibliotheken trotzdem für den Verfassungsblog zahlen dürfen
Indexieren, katalogisieren, archivieren… wenn Ihnen bei diesen Worten die Augenlider schwer werden und Ihr Kopf müde auf die Brust sinkt, dann unterschätzen Sie vielleicht, welche Bedeutung die Arbeit von Bibliotheken hat. Die US-amerikanische Regierung führt uns gerade eindrücklich vor Augen, dass eben noch frei verfügbares Wissen schneller aus dem Internet getilgt ist, als Sie Wissenschaftsfreiheit sagen können. Vor allem in Zeiten eines wachsenden Autoritarismus, der nicht nur Parlaments-, sondern auch Naturgesetze neu schreibt, sind wir angewiesen auf Bewahrer*innen des Wissens – damit wir die Suche nach Erkenntnis nicht immer wieder von vorn beginnen und vergangene Fehler wiederholen müssen.
Nun ist zwar mehr Wissen denn je für mehr Menschen verfügbarer als jemals zuvor, und dennoch sieht es derzeit zugegebenermaßen ganz und gar nicht so aus, als würde uns das davor bewahren, wieder den Weg in den Faschismus zu beschreiten. Demokratisierung des Wissens allein stärkt also nicht automatisch das Wissen um die Demokratie und die Demokratie selbst. Es gibt viele Wissenschaftler*innen, die darum bemüht sind, ihre Forschung und deren Ergebnisse in die Gesellschaft zu tragen, um das Demokratisierungspotenzial des Wissens zu realisieren. Dass es Disziplinen gibt, die geeigneter sind als andere, den öffentlichen Diskurs zu informieren, ist wenig überraschend. Dass die Rechtswissenschaft sich besonders gut dazu eignet, liegt auf der Hand.
Was heißt hier Wissenschaft?
Das Bundesverfassungsgericht definiert Wissenschaft als „jede Tätigkeit, die nach Inhalt und Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist“ (Rn. 128, s. auch hier Rn. 3). In der Rechtswissenschaft bemisst sich die Annäherung an die Wahrheit in weiten Teilen nach dem, was die höchsten Gerichte oder die Mehrheit der Hochschullehrer*innen für vertretbar halten. Der Weg zur herrschenden Meinung ist dabei notwendig gepflastert mit Mindermeinungen, und jeder allgemeinen Ansicht müssen andere Ansichten gegenüberstehen. Es ist dieser Austausch von Meinungen, entfaltet entlang konsentierter Methoden, der kennzeichnend ist für die Rechtswissenschaft und oft genug auch die Grundlage des politischen und öffentlichen Diskurses bildet. Der Verfassungsblog bietet Wissenschaftler*innen eine Plattform, um diesen Diskurs anzustoßen und zu führen, zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, schneller als jede Zeitschrift und mit strengerer Qualitätssicherung als die meisten.
Dass wir keine 30-Seiten-Texte veröffentlichen, Behauptungen und Zitate mit Hyperlinks statt Fußnoten belegen, Lai*innen den Zugang nicht mit „Juristen-Deutsch“ erschweren und ihn Leser*innen oder Autor*innen nicht durch Gebühren verwehren – all das lässt manche an unserer Wissenschaftlichkeit zweifeln. Zuletzt erging es uns so mit dem Directory of Open Access Journals (DOAJ), das Open-Access-Publikationen listet, die die Anforderungen an die technische und inhaltliche Qualität wissenschaftlicher Publikationen erfüllen. Nachdem wir 2022 in das DOAJ aufgenommen worden waren, wurden wir Anfang dieses Jahres daraus entfernt, ganz wesentlich mit der Begründung, dass unser Format nicht wissenschaftlich genug sei (alles zum Hintergrund und dem gesamten Vorgang können Sie hier, hier und hier nachlesen). Der Hinweis, dass unsere Beiträge nicht nur in traditionellen wissenschaftlichen Publikationen, sondern auch von höchsten Gerichten in Deutschland und Europa zitiert werden, hat für die Entscheidung wohl keine Rolle gespielt. Dass ein Richter des Internationalen Gerichtshofs eine Veröffentlichung des Verfassungsblogs gerade erst explizit als „scholarly commentary“ zitiert hat (Sondervotum von Richter Tladi, Equatorial Guinea v. France, Fn. 2), hätte die DOAJ-Redaktion vermutlich auch nicht beeindruckt. Für uns war die Entfernung aus dem Verzeichnis jedenfalls ein Schock, weil die Listung im DOAJ teilweise obligatorisch ist für die Finanzierung von Wissenschaftspublikationen durch wissenschaftliche Bibliotheken. Ob und wie sich die Entfernung auf unsere Konsortialfinanzierung auswirkt, werden wir erst Ende des Jahres wissen.
Wer darf zahlen, wenn keiner zahlt?
In den vergangenen vier Jahren ist es uns – oft mit der Hilfe unserer Autor*innen – immerhin gelungen, 60 wissenschaftliche Bibliotheken und Einrichtungen davon zu überzeugen, dass es sich bei dem Verfassungsblog um eine wissenschaftliche Publikationsplattform handelt, deren Finanzierung notwendig ist und zu ihren Aufgaben gehört. Bei diesen Bemühungen sind wir allerdings gleich auf ein weiteres vermeintliches Hindernis gestoßen: das Wirtschaftlichkeitsprinzip des öffentlichen Haushaltsrechts. Immer wieder begegnen wir der Sorge, dass staatlichen Einrichtungen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die Finanzierung des Verfassungsblogs verwehrt ist. Das liegt daran, dass weder Leser*innen noch Autor*innen uns bezahlen müssen. Es gibt deshalb Leute, die nicht so recht wissen, was sie da kaufen, ob sie überhaupt etwas kaufen, ob sie eigentlich etwas kaufen müssen und ob das alles so mit haushaltsrechten Dingen zugehen kann. Mit diesem Problem stehen wir nicht allein da. Das Wirtschaftlichkeitsgebot ist vielmehr ein Einwand, der so ziemlich allen Diamond-Open-Access-Publikationen – also wissenschaftlichen Publikationen, die keinerlei Gebühren verlangen – immer mal wieder entgegengehalten wird. Im vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderten Projekt „Erwerbungslogik als Diamond-Open-Access-Hindernis: Aus-, Um- und Nebenwege“ (ELADOAH) hatten wir die Möglichkeit zu erforschen, was dran ist an dieser Meinung, und bei den Open-Access-Tagen in Konstanz in der vergangenen Woche durfte ich die vorläufigen Ergebnisse vorstellen.
++++++++++Anzeige++++++++++++
The NYU Law Democracy Project is bringing together experts from across the ideological spectrum to explore the challenges facing democracies in the United States and around the world. The inaugural “100 Ideas in 100 Days” essay series features essays from conservative, liberal and international scholars in the the first sustained bipartisan and ideologically diverse dialogue on democracy in the U.S.
Read more about the Democracy Project and the “100 Ideas in 100 Days” series here.
++++++++++++++++++++++++++++
Um es kurz zu machen: Es handelt sich um ein Scheinproblem. Staatliche Hochschulen und wissenschaftliche Bibliotheken dürfen Diamond-Open-Access-Publikationen grundsätzlich finanzieren. Ihre primären Aufgaben bestehen darin, den freien Zugang zu Wissen zu fördern sowie die Literaturversorgung für das wissenschaftliche Arbeiten – innerhalb wie außerhalb der Hochschule – sicherzustellen. Genau diese Aufgaben erfüllt die Finanzierung. Das Gegenargument, wonach die Finanzierung von Diamond-Open-Access-Publikationen nicht wirtschaftlich sei, weil Publikationen wie Redaktionsarbeit ja ohnehin kostenfrei zur Verfügung stehen, trägt nicht.
Verfassungsrechtlich ergibt sich der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit aus Art. 114 II 1 GG, einfachgesetzlich – und konkretisiert durch Nennung des Sparsamkeitsgebots – insbesondere aus § 7 I 1 Haushaltsgrundsätzegesetz und § 7 I 1 Bundes-/Landeshaushaltsordnung. Er bindet alle staatlichen Stellen und soll sicherstellen, dass öffentliche Ressourcen bestmöglich genutzt werden (s. nur hier, S. 45 m.w.N.). Das Wirtschaftlichkeitsprinzip erfordert im Wesentlichen, dass die Finanzierung Ziele verfolgt, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind und dabei möglichst wenig Mittel aufwendet oder mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das bestmögliche Ergebnis erreicht. Der Staat ist kein privatwirtschaftliches Unternehmen, dessen Handeln allein auf den Zweck der Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Vielmehr verfolgt staatliches Handeln gemeinwohlorientierte Ziele (vgl. Barfeld 2024, S. 85 ff.) und diese Ziele können in bestimmten Fällen besser erreicht werden, wenn nicht die vermeintlich oder kurzfristig sparsamste Variante gewählt wird. Wissenschaftspolitisch besteht deshalb Einigkeit darüber, dass es Aufgabe insbesondere wissenschaftlicher Bibliotheken und Einrichtungen ist, Diamond Open Access zu fördern und zu unterstützen (s. nur Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern, Nr. 1; Empfehlungen des Wissenschaftsrats, S. 67 f.; Strategie der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, S. 8). Das Diamond-Modell stellt nämlich nicht nur bedingungslos sicher, dass öffentlich verfügbar ist, was öffentlich finanziert ist. Es kann mittel- bis langfristig auch dazu beitragen, dem gewinnorientierten wissenschaftlichen Publikationssystem, das mit seinen Preisen und Gewinnmargen völlig aus dem Ruder gelaufen ist, Alternativen entgegenzusetzen, die insgesamt die Kosten senken könnten. Die Finanzierung von Diamond Open Access ermöglicht Wissenschaftler*innen außerdem die freie wissenschaftliche Betätigung (vgl. BVerfGE 43, 242, Rn. 73), unter anderem indem sie der Publikationsfreiheit der einzelnen Wissenschaftler*in Rechnung trägt. All diese Ziele lassen sich nur erreichen, wenn wissenschaftliche Bibliotheken Diamond-Open-Access-Publikationen längerfristig finanzieren.
++++++++++Anzeige++++++++++++
The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law invites doctoral and postdoctoral researchers to apply as “engaged listeners” for the conference “International Law and Emotions: Recovering Universality?” which will take place from 25 to 27 February 2026 in Heidelberg.
Further information on the webpage and the call for engaged listeners.
++++++++++++++++++++++++++++
Oft hören wir, dass kein Leistungsaustausch stattfindet, weil weder Autor*innen noch Leser*innen für Publikationen zahlen müssen. Das entspricht aber nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Richtig ist, dass es sich hier anders als in der traditionellen Literaturerwerbung nicht um einen Kaufvertrag, ein kaufvertragliches Dauerschuldverhältnis oder eine Lizenzierung handelt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Lizenzen offen sind, um eine möglichst umfassende Nachnutzung zu ermöglichen, und dass das Herstellen wissenschaftlicher Werke mit der Digitalisierung den Charakter einer Dienstleistung annimmt. Mit etwas Zeit und Geschick und nicht mehr als einem Textverarbeitungsprogramm kann heute im Prinzip jede*r Zeitschriften oder Bücher im PDF-Format erstellen und dann sogar physische Exemplare als Print on Demand vertreiben. Das Produkt als solches tritt also gegenüber den Arbeiten zu seiner Herstellung in den Hintergrund. Und anders als bei den großen (und auch manchen weniger großen) Wissenschaftsverlagen erstreckt sich diese Herstellung jedenfalls bei wissenschaftsgeleiteten Publikationen darauf, die Qualitätssicherung zu gewährleisten und redaktionell zu arbeiten. Der Geldzahlung stehen also Publikationsdienste gegenüber, die publizierenden Wissenschaftler*innen und wissenschaftlichen Bibliotheken unmittelbar zur Verfügung stehen, sodass es sich weder um eine Spende noch um eine Zuwendung, Subvention oder Förderung handelt.
Aus alt wird neu wird unrechtmäßig?
Es ist beinahe komisch, dass ich seit nunmehr vier Jahren Open-Access-Arbeit mit dem wissenschaftlichen Bloggen immer wieder etwas als innovativ bezeichnen muss, das schon seit über 20 Jahren existiert und im wissenschaftlichen Publikationssystem mittlerweile durchaus etabliert ist. Manche können Wissenschaftsblogs wie den Verfassungsblog aber noch immer nur dann als wissenschaftlich akzeptieren, wenn sie das Format als etwas bislang nicht Dagewesenes, Aufregendes, Neues begreifen. Wo man auch hinsieht, brechen alte Gewissheiten und Gewohnheiten in sich zusammen, während die Zeitschrift monolithisch, stabil und exklusiv als Form seriellen wissenschaftlichen Publizierens besteht. Dass die Gesellschaft sich immer weniger darüber einig ist, was wahr ist und was falsch, wie die Welt beschaffen ist und was daraus folgt, scheint jedenfalls nicht Grund genug darüber nachzudenken, was Wissenschaft sein kann oder soll.
Ebenso wenig vorstellbar erscheint es manchen, dass Literaturversorgung in etwas anderem bestehen könnte als dem Zeitschriftenabo, Bücherkauf oder der Datenbanklizenz. Währenddessen müssen Verwaltungen staatlicher Hochschulen und wissenschaftlicher Bibliotheken schon lange damit umgehen, dass sich mit den Möglichkeiten des Publizierens auch der Literaturerwerb verändert. In der Welt des Rechts tut man sich allerdings schwerer, mit dem Alten im neuen Gewand umzugehen, ohne Probleme zu entdecken, die nur auf eine Weise, auf verschiedenste Weisen oder gar nicht zu lösen sind. Aber wo kämen wir auch hin, wenn wir uns plötzlich einig wären?
*
Editor’s Pick
von JANA TRAPP
 Wenn die ersten Blätter fallen und die Luft nach Rückzug riecht, greife ich fast automatisch zu vertrauter Musik: Fleetwood Macs Greatest Hits von 1988 fädelt sich in eine Stimmung ein, die zwischen Leichtigkeit und Wehmut schwebt. „Everywhere“ trägt warm durch die goldenen Herbsttage, „Dreams“ bringt eine stille Nachdenklichkeit in die rot-gelben Landschaften, und „Little Lies“ erinnert daran, wie nah Freude und Verletzlichkeit beieinander liegen. Zwischen diesen Songs entfaltet sich etwas Schlichtes und Schönes: Sie erzählen nicht nur von Liebe, sondern davon, wie man in der Vergänglichkeit etwas Vertrautes findet. Im Rhythmus der Jahreszeiten klingt dieses Album jedes Jahr wieder ein kleines bisschen neu – und bleibt doch immer dasselbe Zuhause.
Wenn die ersten Blätter fallen und die Luft nach Rückzug riecht, greife ich fast automatisch zu vertrauter Musik: Fleetwood Macs Greatest Hits von 1988 fädelt sich in eine Stimmung ein, die zwischen Leichtigkeit und Wehmut schwebt. „Everywhere“ trägt warm durch die goldenen Herbsttage, „Dreams“ bringt eine stille Nachdenklichkeit in die rot-gelben Landschaften, und „Little Lies“ erinnert daran, wie nah Freude und Verletzlichkeit beieinander liegen. Zwischen diesen Songs entfaltet sich etwas Schlichtes und Schönes: Sie erzählen nicht nur von Liebe, sondern davon, wie man in der Vergänglichkeit etwas Vertrautes findet. Im Rhythmus der Jahreszeiten klingt dieses Album jedes Jahr wieder ein kleines bisschen neu – und bleibt doch immer dasselbe Zuhause.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
Mit dem Alten im neuen Gewand umzugehen, fordert innerhalb der Welt des Rechts vor allem die Heimstätten des Wissens heraus: die Universitäten. Spätestens im Jahr 2030 wird Künstliche Intelligenz juristische Standardprobleme im Handumdrehen lösen und darstellen können. Da reiben sich die Studierenden die (freien) Hände, wenn Fakultäten weiterhin Hausarbeiten verlangen. Was dann? Schreiben Studierende 2030 „KI-Hausarbeiten“ mit deutlich komplexeren Problemstellungen? MARTIN FRIES, SUSANNE LILIAN GÖSSL, SUSANNE HÄHNCHEN, MARTIN HEIDEBACH, CHRISTOPH KRÖNKE, MICHAEL BENJAMIN STRECKER, THOMAS WISCHMEYER und MARTIN ZWICKEL (DE) stellen drei Thesen zu juristischem Prüfen 2030 auf.
„Dass die Gesellschaft sich immer weniger darüber einig ist, was wahr ist und was falsch, wie die Welt beschaffen ist und was daraus folgt“, wie EVIN DALKILIC oben im Leitartikel beobachtet, stellt nicht nur die Wissenschafts-, sondern vor allem die Meinungsfreiheit auf die Probe. In den USA scheint sich das nun zur Zerreißprobe zuzuspitzen: ROBERT POST (EN) – einer der führenden Experten für Meinungsfreiheit – unterrichtet seit über 40 Jahren US-Verfassungsrecht zum Ersten Zusatzartikel. Zum ersten Mal fürchtet er, dass die Meinungsfreiheit in Amerika tatsächlich in Gefahr ist.
Auch in Deutschland geht es der Meinungsfreiheit an den Kragen, und zwar unter dem trendigen Deckmantel der Neutralität: Neuerdings hält Neutralität sogar als Voraussetzung für das demokratische Funktionieren von NGOs und deren staatlicher Unterstützung her. PAULA DIEHL (DE) zeigt sich besorgt: Die Verwechslungen und Missverständnisse im Neutralitätsdiskurs könnten die Meinungsfreiheit gefährden.
Genau diese Sorge macht sich auch in der Debatte zum „Catcalling“ breit: Kritiker*innen warnen davor, dass ein entsprechender Straftatbestand zu unbestimmt und deshalb verfassungswidrig sei. Für ELISA HOVEN (DE) geraten dabei die eigentlichen Schutzinteressen aus dem Blick: Verfassungs- und strafrechtsdogmatisch spreche wenig gegen eine klar begrenzte Norm, und politisch gehe es darum, Frauenrechte nicht gegen andere Gleichheitsanliegen auszuspielen, sondern Sexualautonomie als legitimes Schutzgut strafrechtlich anzuerkennen.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Unser neustes Verfassungsbook: „Die vorbereitete Demokratie: Resilienz durch Antizipation im Thüringen-Projekt“ (Friedrich Zillessen, Hrsg.)
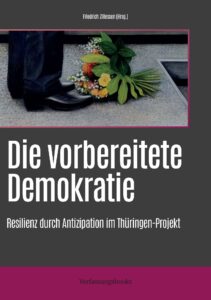
Das Thüringen-Projekt hat in zahlreichen Szenarien Einfallstore identifiziert, die autoritär-populistische Parteien für ihren Machterhalt missbrauchen könnten. Für diesen Sammelband haben wir 35 Blogposts aus dem Thüringen-Projekt ausgewählt, die über tagespolitische Ereignisse hinaus Relevanz entfalten.
Die Beiträge sind in fünf Überkapitel strukturiert, Legislative, Exekutive und Judikative, sowie Öffentlichkeit & Zivilgesellschaft. Das fünfte Kapitel, „Wen es trifft“, widmet sich jenen Menschen, die im Falle einer autoritär-populistischen Machtverschiebung besonders vulnerabel und schutzwürdig sind.
Entdecken Sie unser neustes Verfassungsbook, mit einem Vorwort von Sabine Leutheusser Schnarrenberger und einem zurückblickenden, reflektierenden Kapitel des Thüringen-Teams.
++++++++++++++++++++++++++++
Der EuGH beschäftigt sich währenddessen mit der Anerkennung der sexuellen Identität: Anfang des Monats hat Generalanwalt de la Tour sein Gutachten im Fall Shipov abgegeben. Darin geht es um die Anerkennung des Geschlechts einer trans Frau, die ursprünglich aus Bulgarien stammt – einem Land, in dem dies praktisch unmöglich ist. ALINA TRYFONIDOU (EN) begrüßt das Gutachten und skizziert dessen mögliche Auswirkungen.
Ein weiteres druckfrisches Gutachten gibt es von Generalanwältin Ćapeta im Fall Aucrinde. In diesem ersten Verfahren zur Recast Evidence Regulation überträgt das Gutachten einen aus dem Strafrecht bekannten Test auf die zivilrechtliche Zusammenarbeit – für EMILIA SANDRI (EN) ein erstes Indiz dafür, dass der Zwei-Stufen-Test nun auch in der zivilrechtlichen justiziellen Zusammenarbeit Anwendung findet.
Zwischen Straf- und Zivilrecht liegt auch das Urteil des brasilianischen Arbeitsgerichts, das Volkswagen do Brasil wegen Sklavenarbeit zu einer Zahlung von US$ 30 Million verpflichtete. Nachdem DANIELLE ANNE PAMPLONA und HARTMUT RANK die Entscheidung als „historic, consistent & necessary“ lobten, weist DIMITRI DIMOULIS (EN) auf Inkonsistenzen hin: Der brasilianische Fall betreffe eine zivilrechtliche Schadenersatzklage, und das Arbeitsgericht sei nicht zuständig für die Beurteilung von Straftaten im Zusammenhang mit Zwangsarbeit. Während geschätzt über eine Million Brasilianer*innen unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten, helfe ein symbolisches Urteil wenig.
In Deutschland lassen sich Fehlurteile nur schwer korrigieren. Das Wiederaufnahmeverfahren ist mit hohen Hürden verbunden, wie die Fälle Manfred G. und Josephine R. zeigen. LAURA FARINA DIEDERICHS (DE) fordert deshalb Reformen – und eine Fehlerkultur, die Offenheit und Mut zur Selbstkorrektur einschließt.
In Israel steht dagegen das Justizsystem als Ganzes unter Druck: Die umstrittene Justizreform löste 2023 eine Verfassungskrise aus, der Hamas-Angriff am 7. Oktober einen nationalen Notstand. Doch entgegen aller Erwartungen stoppte der Sicherheitsnotstand die Justizreform nicht. Im Gegenteil, argumentiert YANIV ROZNAI (EN): Er sei zum perfekten Vorwand geworden, um die populistische Verfassungsagenda der Regierung weiter voranzutreiben.
Während die Kriege weitergehen, wird wieder lauter über die Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine nachgedacht. Am Samstag diskutierte Brüssel über ein Reparationsdarlehen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten. MAXIMA HUBBES (DE) zeigt, warum diese Option für die EU und die Ukraine besonders vielversprechend ist.
Mit den Kriegen in Europa ist nun auch die Wehrpflicht nur eine Verordnung entfernt: Ende August hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem diese die Wehrpflicht per Verordnung wieder einführen könnte – der Bundestag müsste lediglich zustimmen. Dies hält WILHELM ACHELPÖHLER (DE) für verfassungswidrig: Eine derart wesentliche Entscheidung sei allein Sache des Parlaments.
Mit dieser Begründung erklärte damals auch das BVerfG den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig. Doch die Idee der Mietpreisbremse europäisiert sich. Während sich die Wohnungsnot in europäischen Großstädten verschärft, setzen die Regierungen auf Mietkontrollen – aber wie weit dürfen sie gehen, bevor sie Eigentumsrechte verletzen? Und was sagen die Gerichte dazu? ALLEGRA GRILLO, ARNULFO DANIEL MATEOS DURÁN und ALESSIO SARDO (EN) liefern rechtsvergleichende Antworten auf die Wohnkrise.
Neben der Wohn- verschärft sich auch die globale Schuldenkrise. Damit wächst der Druck auf mehr Transparenz im Umgang mit Auslandsschulden, besonders von Seiten des IWF und der Weltbank. Um Transparenz nicht nur als gute Praxis, sondern als verbindliches Prinzip zu verankern, müssen öffentliche Schulden aus verfassungsrechtlicher Perspektive analysiert werden, fordert JOSÉ IGNACIO HERNANDEZ (EN).
Und auch im Völkerrecht wird ständig die Krise ausgerufen. BARDO FASSBENDER (EN) gibt Entwarnung: Das zeitgenössische Völkerrecht stecke zwar in der Krise – aber noch nicht in einer systemischen. Das bestehende System werde weiterbestehen, doch ohne Reform schleichend geschwächt: Normen und Institutionen der Vergangenheit verlören an Gewicht, würden marginalisiert und verkümmerten. Wir müssten uns auf eine lange Phase der „Atrophie“ einstellen.
Die Muskeln des Völkerrechts mögen atrophisch verkümmern, aber Ihre und unsere hoffentlich nicht. Genießen Sie sicherheitshalber einen Herbstspaziergang mit Fleetwood Mac: Thunder only happens when it’s raining.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.