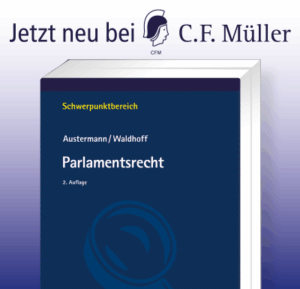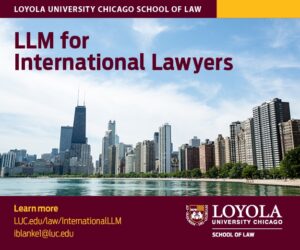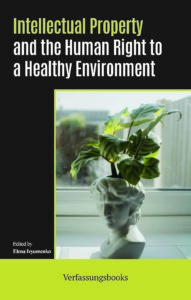„Ein Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker“
Fünf Fragen an Jochen von Bernstorff
Vor rund einer Woche einigten sich die Hamas und Israel auf die erste Phase des US-Friedensplans. Die Kämpfe wurden eingestellt, Geiseln freigelassen, Gefangene entlassen. Inzwischen droht Israel, die Kämpfe wieder aufzunehmen, wenn sich die Hamas nicht an den Waffenstillstand hält und nicht sämtliche Überreste der verstorbenen Geiseln übergibt. Der 20-Punkte-Plan reicht weit, von humanitärer Hilfe über Sicherheitsfragen bis hin zu Verwaltung und „Selbstbestimmung“. Doch wie belastbar ist dieses Abkommen im Lichte des Völkerrechts – und was kann es in einem so ungleichen Konflikt leisten? Das haben wir Jochen von Bernstorff gefragt, Professor für Staatsrecht, Völkerrecht, Verfassungslehre und Menschenrechte an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
1. Friedensplan, Waffenstillstand und Friedensvertrag – in der öffentlichen Debatte sind diese Begriffe gerade in aller Munde. Können Sie erklären, was diese Begriffe im Völkerrecht eigentlich bedeuten und wie sie sich unterscheiden?
Ein Friedensplan kann ein völkerrechtlicher Vertrag sein, muss es aber nicht. Präsident Trumps 20-Punkte-Plan in seiner öffentlich zugänglichen Form ist nicht als völkerrechtlicher Vertrag formuliert, sondern eben nur ein politischer Vorschlag des US-Präsidenten, dem zunächst der israelische Regierungschef Netanyahu und dann weitere Staatenvertreter beigepflichtet hatten. Ob dahinter noch nicht veröffentlichte und völkerrechtlich verbindliche Abreden von der US-Administration mit einzelnen oder mehreren Staaten getroffen wurden, ist bislang nicht einsehbar. Selbst die teilweise Zustimmung von einzelnen palästinensischen Vertretern – die unter der zumindest impliziten Androhung massivster Gewaltanwendung erfolgte – macht aus dem Plan selbst keinen völkerrechtlichen Vertrag. Das ganze Vorgehen Präsident Trumps ist eher durch die Abwesenheit von völkerrechtlicher Verbindlichkeit und von Missachtung der auf den Konflikt anwendbaren Regeln des Völkerrechts geprägt. Ein Friedensvertrag zwischen Israel und Palästina ist auch für die Zukunft gerade nicht geplant. Auch der im Plan vorgesehene Waffenstillstand ist nur eine faktische Einstellung von Kampfhandlungen als Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch. Damit ist aber weder die Anwendung des Besatzungsrechts in Gaza noch der zugrundeliegende internationale bewaffnete Konflikt beendet worden.
2. Wenn der Plan also keine rechtlich verbindliche Grundlage bildet – worauf genau haben sich Hamas und Israel bislang geeinigt und wie ist der Inhalt des 20-Punkte-Plans völkerrechtlich einzuordnen?
Zunächst muss man anerkennen, dass durch die erste Stufe des sogenannten Friedensplans nun endlich die letzten israelischen Geiseln, die während des brutalen Hamas-Massakers an der israelischen Zivilbevölkerung am 7. Oktober 2023 verschleppt worden waren, freigelassen wurden. Hinzu kommt die Freilassung von 1950 ganz überwiegend ohne rechtstaatliche Verfahren inhaftierten Palästinenser*innen. Zudem scheint auch der Waffenstillstand zumindest weitgehend zu wirken. Die als Selbstverteidigungsakt begonnene militärische Reaktion der israelischen Regierung auf den 7. Oktober 2023 hatte schon nach einigen Wochen unverhältnismäßige Züge angenommen. Sie führte in der Folge zu einer Zerstörung des palästinensischen Lebens in Gaza durch schwerste israelische Kriegsverbrechen, die zumindest teilweise bei entsprechender Absicht sogar als genozidales Vorgehen eingestuft werden müssen. Dass nun endlich die Bombardements eingestellt wurden und humanitäre Hilfe in den Gaza-Streifen kommt, ist als solches erst einmal ein großartiger und hoffentlich auch weiter andauernder Erfolg des 20-Punkte-Plans.
Hinter dem Konflikt liegt jedoch eine völkerrechtliche Ausgangslage, die in allen erfolgreichen Friedensverhandlungen eine wie auch immer definierte Rolle spielen wird: Israels über Jahrzehnte andauernde Besetzung in den palästinensischen Gebieten ist rechtswidrig und muss laut dem IGH schnellstmöglich beendet werden. Dazu gehört insbesondere auch der forcierte israelische Siedlungsbau im besetzten Westjordanland. Zudem hat eine gute Zweidrittelmehrheit der Staaten Palästina bereits als Staat anerkannt. Ich stimme denjenigen Stimmen zu, die in der von Präsident Trumps 20-Punkte-Plan vorgesehenen neuen Verwaltung des Gaza-Streifens, sollte sie Wirklichkeit werden, einen Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker sehen. Dies zumindest so lange, wie eine ausdrückliche und freie Zustimmung einer repräsentativen palästinensischen Regierung zu diesem Teil des Plans ausbleibt. In Punkt 19 des Plans ist zwar vom Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und sogar von palästinensischer Staatlichkeit die Rede, allerdings bewusst nicht im Sinne einer Anerkennung des palästinensischen Selbstbestimmungsrechts. Anerkannt wird in Präsident Trumps Plan bei genauerem Hinsehen in fast schon zynischer Weise nur der Wunsch („aspiration“) des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung und einen eigenen Staat.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Das Parlamentsrecht formt den Rechtsrahmen für die Abgeordneten, für die (Selbst-)Organisation und die Willensbildung im Deutschen Bundestag. Sein Gegenstand sind u.a. die Rechtsstellung der Abgeordneten, Fraktionen und Gruppen, Selbstorganisation und Organe des Parlaments, seine Handlungsformen und Funktionen wie Gesetzgebung, Regierungskontrolle und Budgetrecht. Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Rechtsänderungen und neueste Rechtsprechung.
Weitere Infomationen hier.
++++++++++++++++++++++++++++
3. Wenn es mehr um externe Kontrolle als um Selbstverwaltung geht, wie sähe unter diesen Bedingungen die politische und ökonomische Zukunft Gazas aus?
Laut dem Plan soll in der zweiten Phase eine technokratische palästinensische Übergangsregierung eingesetzt werden, die von einem „peace board“ unter dem Vorsitz Trumps überwacht wird. Die Übergangsregierung soll ausländisches Kapital anwerben, um einen ökonomisch definierten Wiederaufbau („New Gaza“) zu ermöglichen. Geplant ist gerade keine UN-Übergangsverwaltung für Gaza. Die UNO bzw. der Sicherheitsrat soll – anders als im Kosovo nach 1999 – eine solche Rolle in Gaza nicht übernehmen. Dies entspricht der bewussten Missachtung aller formalisierten multilateralen Foren durch die Trump-Administration. Indem die US-Regierung unter Präsident Trump nach dem Friedensplan die eingesetzte Übergangsregierung selbst überwacht, würde die Situation eher derjenigen entsprechen, die völkerrechtshistorisch als „informaler Imperialismus“ bezeichnet wird. Eine Großmacht setzt aus geopolitischen und ökonomischen Interessen durch militärischen Druck eine sog. Klientel-Regierung („client government“) ein, die unter der impliziten oder expliziten Drohung von militärischer Gewaltanwendung gemäß den Interessen der imperialen Großmacht handelt. Die Gewaltandrohung ergibt sich beim Plan des US-Präsidenten aus der fortdauernden Präsenz der militärisch überlegenen und u.a. von den USA ausgerüsteten israelischen Streitkräfte in oder an der Grenze zu Gaza. Neu ist hier im Vergleich zum klassischen informalen Imperialismus nur die große Unverblümtheit, mit der der 20-Punkte-Plan eine solche externe Kontrolle einsetzt.
Die Autonomiebehörde, die die offizielle palästinensische Regierung darstellt, aber seit Jahren in Gaza über keine effektive Regierungsgewalt mehr verfügt, soll laut dem Friedensplan erst nach einem nicht definierten Reformprozess Regierungsverantwortung übernehmen; das heißt konkret, wenn das „peace board“ unter der Leitung des US-Präsidenten sie als (Klientel-) Regierung für geeignet hält. Die Machtfülle der US-Regierung im Blick auf das weitere Schicksal Palästinas wäre nach dem 20-Punkte-Plan sogar noch größer als diejenige, über die Großbritannien in der Zwischenkriegszeit als Mandatsmacht des Völkerbunds für Palästina verfügte. Die aktuelle historische Forschung zu Nationen unter informaler Fremdherrschaft im 19. und 20. Jahrhundert zeigt, dass es unter solchen extern gesetzten Bedingungen in aller Regel zu strukturell instabilen politischen und ökonomischen Verhältnissen in den betroffenen Gesellschaften kommt. Ökonomisch und geopolitisch profitieren grundsätzlich nur die Großmacht und die eingesetzte Klientelregierung, nicht aber die breitere Bevölkerung im Klientelstaat.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Transform your career with Loyola Chicago’s top-ranked LLM for International Lawyers, built on the core principles of academic excellence, affordability, and flexibility. Choose from 160+ courses taught by distinguished and engaged faculty, access tailored career support, and gain hands-on experience in the heart of vibrant Chicago, a major legal and financial hub. Loyola’s LLM empowers ambitious lawyers from diverse backgrounds to excel as ethical global leaders.
Curious? Reach out to Insa Blanke, Exec Dir of International LLM and SJD Programs, Loyola University Chicago School of Law.
++++++++++++++++++++++++++++
4. Trump missachtet zwar die völkerrechtlichen Formen. Doch selbst wenn er sich daran hielte, wäre sein Spielraum groß – denn für das ius post bellum, das Recht der Nachkriegszeit, gibt es deutlich weniger völkerrechtliche Regeln als für das ius in bello, das Kriegsrecht. Welche Funktion kann das Völkerrecht in dieser Zwischenphase überhaupt erfüllen?
Aus völkerrechtlicher Sicht gibt es trotz vieler wissenschaftlicher Debatten seit den 1990er-Jahren über die Beendigung von Bürgerkriegen keinen eigenen Korpus von Regeln für ein ius post bellum. Dieser Befund gilt insbesondere für zwischenstaatliche Konflikte. Erst einmal gilt das Kriegsrecht (ius in bello) – und zwar insbesondere auch das dazugehörige Besatzungsrecht – weiter, bis die militärische Besetzung in Gaza faktisch beendet ist. Menschenrechte bleiben ohnehin immer anwendbar, solange sie nicht durch spezielle Regeln des ius in bello verdrängt werden. Das ist wichtig, weil Israel oder auch jede andere militärische Besatzungsmacht eine ganze Reihe von Verpflichtungen aus dem Besatzungsrecht und Menschenrechten gegenüber der Bevölkerung in Gaza hat. Dazu gehört vor allem die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Ausrüstung sowie die Achtung der lokalen Rechtsordnung, einschließlich der bestehenden Eigentumsverhältnisse. Alle weiteren völkerrechtlichen Fragen könnte ein späterer Friedensvertrag zwischen Israel und einer repräsentativen palästinensischen Regierung regeln, etwa den Verzicht auf bestimmte territoriale völkerrechtliche Ansprüche, Sicherheitsgarantien oder Bestrafung und Amnestien für begangene Kriegsverbrechen.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Umwelt- und Klimaschutz im Mehrebenensystem – eine Anfrage an das europäische Verfassungsrecht
Angesichts des gegenwärtigen Umbaus und teilweisen Rückbaus von Regelungen zum Umwelt- und Klimaschutz, die zwischen 2019 und 2024 beschlossen wurden, hält das Dimitris-Tsatsos-Institut eine Rückbesinnung auf den konstitutionellen Status von Umwelt- und Klimaschutz im europäischen Mehrebenensystem für angebracht. Im Zentrum des Symposions steht die Frage, ob das europäische Verfassungsrecht dem Gestaltungswillen politischer Mehrheiten auf Unions- und nationaler Ebene Grenzen setzen kann.
28. & 29. November 2025, FernUniversität in Hagen und online über Zoom.
Näheres hier.
++++++++++++++++++++++++++++
5. Nach allem, was Sie beschrieben haben, wird der Friedensprozess von krassen Machtasymmetrien bestimmt: Die USA steuern den Wiederaufbau Gazas sowie die palästinensische „Selbstbestimmung“ und schließen multilaterale Institutionen aus, während Israels Besatzung weitergeht. Trägt Deutschland unter diesen Bedingungen eine besondere Verantwortung, um auf einen faireren Friedensprozess hinzuwirken?
Deutschland hat derzeit, auch durch seine Positionierungen während des Konflikts, international keine Rolle als neutraler Vermittler. Umso wichtiger wäre es für Deutschland und andere mittelgroße Staaten, jetzt darauf hinzuwirken, dass die zentralen Akteure den völkerrechtlichen Rahmen nicht vollständig ignorieren. Denn dieser Rahmen schützt über das Selbstbestimmungsrecht die schwächere Seite in diesem Konflikt. Trotz aller Konzessionen, die mit einem echten Friedensschluss regelmäßig einhergehen, kann nach über fünfzigjähriger israelischer Besetzung das Recht auf einen eigenständigen palästinensischen Staat nicht mehr übergangen werden. Dies wäre bei einer Umsetzung des gesamten 20-Punkte-Plans aber auf absehbare Zeit weiter der Fall.
*
Editor’s Pick
von DILLON DAVIS
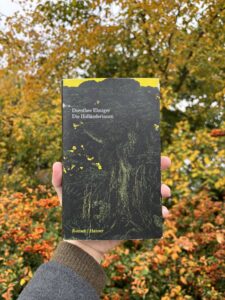
Wann hört das Zuhören auf und wo fängt das Erzählen an?
Diese Fragen lassen mich, seit ich Dorothee Elmigers neuen, fast ausschließlich in indirekter Rede verfassten Roman gelesen habe, nicht mehr los. In „Die Holländerinnen“ berichtet – so scheint es – eine unbekannte Zuhörerin von einer Poetikvorlesung. Gehalten wird diese von einer namenlosen, aber bedeutenden Schriftstellerin, deren Schaffen sich in „einem Prozess der Auflösung befinde“. Statt eine Poetikvorlesung zu halten, berichtet sie daher von einer Reise in die Tropen, die sie vor etwa drei Jahren unternommen hatte, um an einem Theaterstück über zwei verschollene Studentinnen aus den Niederlanden mitzuwirken. Inmitten von Mangroven beginnen die Mitreisenden, ihre Geschichten von Angst, Gewalt und der Verlorenheit in der Welt zu erzählen.
Dabei habe ich in diesem Urwald aus Erzählungen und Erzählungen von Erzählungen schließlich etwas ganz anderes gefunden: das Unerzählte, eine Fotografie ohne Farben und Formen, eine Erfahrung, die selbst keine Sprache mehr finden kann.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
Frieden wird in Friedenszeiten gewahrt, insbesondere durch friedliche Versammlungen. Das macht die Versammlungsfreiheit so elementar – und zur Zielscheibe von Autokratien weltweit. Was Straßenproteste voraussetzen und bewirken können, erklärt JAN-WERNER MÜLLER (EN).
Allerdings bedrohen nicht nur Autokraten das Versammlungsrecht. Auch wer die Demokratie verteidigen will, kann sie verwunden. Ein aktuelles Beispiel liefert Darmstadt: Die Stadt hat eine Versammlung in der sogenannten Brandnacht verboten, der Nacht vom 11. auf den 12. September, als 1944 etwa 12.000 Menschen einem Luftangriff der Alliierten zum Opfer fielen. Obwohl die rechte Versammlung eindeutig zulässig war, hielt die Stadt an einem Verbot fest. WOLFGANG HECKER (DE) zu den demokratischen Kosten von Kommunen, die sich im Kampf gegen Rechts gegen das Recht stellen.
Deutschland diskutiert gerade vor allem über die buchstäbliche Verteidigung der Demokratie – die Wehrpflicht. CDU und CSU haben nun vorgeschlagen, bei deren neuer Ausgestaltung das Los entscheiden zu lassen. In der politischen Linken stößt der Vorschlag auf Ablehnung. Warum das kein Zufall ist und wann Losen das rationalste aller Entscheidungsverfahren sein kann, zeigt HUBERTUS BUCHSTEIN (DE).
Glücklicherweise entscheidet der Internationale Gerichtshof nicht per Los. Dennoch wird ein neuer Ansatz als willkürlich kritisiert: Der Gerichtshof weicht zunehmend von seinem traditionellen fünfstufigen Test für vorläufige Maßnahmen ab und wählt stattdessen zwischen einzelnen Stufen aus. Dieser „Pick-and-Choose“-Ansatz sei zwar praktisch, aber auch riskant, weil er Willkür und Unberechenbarkeit begünstige, so das Fazit von QUAZI OMAR FOYSAL (EN).
Der Internationale Strafgerichtshof hat mit einem ganz anderen „Pick and Choose“ zu kämpfen: Mali, Burkina Faso und Niger traten aus dem Statut aus und feierten dies als Akt souveräner Selbstbestimmung. Doch dahinter stecke vor allem der Wunsch nach Straflosigkeit von Militärjuntas, die gewaltsam an die Macht kamen und Verantwortlichkeit ausweichen wollen, wie DAVIT KHACHATRYAN (EN) analysiert.
Aus ganz ähnlichen Motiven verließen schon 2002 die USA den Internationalen Strafgerichtshof – ein Jahr vor dem Irakkrieg. Nun tauchen altbekannte Architekten des Krieges wieder auf: Condoleezza Rice, John Bolton und Philip Zelikow geben in Berlin Empfehlungen für eine erneuerte US-Führungsrolle ab. MALCOLM JORGENSEN (EN) warnt davor, die Neokonservativen zu rehabilitieren, und zeigt, warum gerade sie keine neue Sicherheitsordnung entwerfen sollten.
In der neuen Sicherheitsordnung scheinen sich auch die Feindeslinien zu verschieben: Angeblich operierten ungarische Geheimdienstoffiziere innerhalb von EU-Institutionen, während Oliver Várhelyi, damals Ungarns Ständiger Vertreter bei der EU und heute EU-Kommissar, im Amt war. Das stellt die Union vor eine neue Herausforderung für ihre institutionelle Selbstverteidigung. ALBERTO ALEMANNO (EN) skizziert, wie die EU mit dieser umgehen kann.
Auch im Inland zieht Ungarn Feindeslinien. Ein 2025 verabschiedetes Gesetz zum Schutz der lokalen Identität gibt den Gemeinden die Macht zu bestimmen, wer dort leben darf. Unter dem Deckmantel von „Tradition“ und „Gemeinschaftswerten“ werde das Gesetz so zu einem perfiden, legalisierten Instrument von Rassendiskriminierung insbesondere gegenüber Roma, wie ANGÉLA KÓCZÉ (EN) erklärt.
Angesichts solcher Gesetze kann einem der Vorrang des EU-Rechts manchmal wirkungslos vorkommen. Umso wichtiger ist es, ihn zu stärken. Genau das hat der EuGH nun getan, als er die Beschlüsse der polnischen Kammer für außerordentliche Kontrolle für nichtig erklärte. Das Urteil in AW ‘T’ werde wegweisend für die polnische Justiz und den Umgang mit der Rechtsstaatskrise, so die Einschätzung von BARBARA GRABOWSKA-MOROZ (EN).
In der Beitrittskandidatin Türkei verschärft sich dagegen die Rechtsstaatskrise: Ekrem İmamoğlu, Bürgermeister von Istanbul, sitzt seit 200 Tagen ohne Anklage in Haft, während die türkische Regierung die Justiz einsetzt, um politische Opposition zu beseitigen. Für AYŞEGÜL KARS KAYNAR (EN) zeigt der Fall, wie autokratischer Legalismus zu „Lawfare“ übergeht, also zur strategischen Nutzung rechtlicher Mittel, um die demokratische Konkurrenz zu unterdrücken.
Neben autoritären Regimen stehen auch KI-Entwickler*innen vor der Frage, wie Macht über Menschen ausgeübt und kontrolliert wird. Ende August verklagten die Eltern eines 16-Jährigen OpenAI und dessen CEO, nachdem ihr Sohn Suizid begangen hatte – angeblich beeinflusst durch ChatGPT. Der Fall befeuerte die Debatte über die psychischen Risiken von KI-Chatbots für Minderjährige. CRISTINA FRATTONE und FEDERICO RUGGERI (EN) fordern endlich entsprechende Schutzmechanismen im Design.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Intellectual Property and the Human Right to a Healthy Environment
Edited by Elena Izyumenko
“This timely volume tackles a new and important topic: how can we harness the intellectual property system to promote the human right to a healthy environment? Featuring scholarship on human rights, intellectual property and environmental law, the book identifies multiple pathways to foster a constructive relationship between these areas to promote environmental sustainability. Highly recommended!”
– Peter K. Yu, Texas A&M University
“This book presents a set of eclectic views centred on the themes of the right to a healthy environment, climate change, clothing upcycling and intellectual property law. The intersection of these legal norms highlights the challenges of reconciling intellectual property law with the human right to a healthy environment.”
– Ian Fry, Australian National University, Former UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Climate Change (2022-2023)
Available as soft copy (open access) and in print!
++++++++++++++++++++++++++++
Besonders schutzbedürftig sind auch geflüchtete Menschen. Doch wird ihnen dieser Schutz immer wieder versagt – nicht nur per Gesetz, sondern auch per Gesetzesausführung. So verlangen trotz der klaren Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu Gesundheitsdienstleistungen viele Behörden weiter „Behandlungsscheine“ von Geflüchteten – und verwehren so oft essenzielle medizinische Versorgung. HANNAH FRANKE und SALOMON GEHRING (DE) zu einer problematischen Praxis und deren Folgen.
Diese Woche haben wir außerdem unser „Defund Meat“ (EN) Symposium fortgesetzt: Im Kontext strategischer Prozessführung warnt LAURA BURGERS, dass Aktivist*innen ihre rechtlichen Optionen sorgfältig abwägen müssen, damit nationalistische Populisten die Urteile nicht politisch ausnutzen. Statt im Tierrechtsdiskurs entweder von Tierschutz oder von Grundrechten auszugehen, plädiert EINAT ALBIN für Arbeitsrechte. CASS SUNSTEIN erklärt, wie Nudging den Fleischkonsum reduzieren könnte. Die Ökonomen ROMAIN ESPINOSA und NICOLAS TREICH gehen der Frage nach, ob Fleisch besteuert werden sollte, um seine Auswirkungen auf das Tierwohl zu berücksichtigen, und machen konkrete Vorschläge für eine Tierwohlabgabe. KIRSI-MARIA HALONEN argumentiert, dass gezielt gestaltete sektoralrechtliche Vorschriften in der Lebensmittelversorgung dazu beitragen können, pflanzenbasierte Mahlzeiten zu fördern und den Fleischkonsum zu senken.
Und schließlich haben – als Teil des EU-geförderten Projekts FOCUS – ein neues Symposium gestartet: „Mapping Article 13: Academic and Scientific Freedom under the EU Charter“ (EN), herausgegeben von Vasiliki Kosta und Marie Müller-Elmau. Denn die Wissenschaftsfreiheit steht unter Druck: Sie ist zwar in Artikel 13 der EU-Charta verankert, doch fliegt sie in Forschung, EU-Institutionen und Rechtsprechung weitgehend unter dem Radar – bis jetzt. Während die Wissenschaftsfreiheit weltweit angegriffen wird, formt sich ihre Bedeutung nun in Echtzeit. VASILIKI KOSTA eröffnet das Symposium und richtet dabei den Blick auf das Zukunftspotenzial von Artikel 13. CHRISTINA ANGELOPOULOS argumentiert, dass Open Access – indem es Forschende dazu ermutigt, ihre Urheberrechte offen zu veröffentlichen – eine grundsätzliche Debatte über die Wissenschaftsfreiheit erzwingt. KIRSTEN ROBERTS LEYER untersucht den Versuch der US-Administration, die Bundesförderung an einen ideologisch geprägten „Compact for Academic Excellence“ zu koppeln, zieht Parallelen zur EU und plädiert dafür, dass die EU akademische Freiheit nicht nur als sektoral relevante Frage, sondern als Grundrecht gemäß Artikel 13 GRC schützt. KRISZTA KOVÁCS und JULIAN LEONHARD beleuchten die Spannungen zwischen Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit an Universitäten. ANDRÁS L. PAP zieht acht Lehren für die Wissenschaftsfreiheit aus den Erfahrungen Ungarns. Da Wissenschaft zunehmend ins Zentrum nationaler Sicherheitsdebatten rückt, argumentiert RAFFAELA KUNZ, dass Artikel 13 die Wissenschaftsfreiheit auch vor subtilen politischen oder marktgetriebenen Einflüssen schützen müsse. ETIENNE HANELT beschreibt, wie das international kaum bekannte, mit Orbán verbundene Mathias Corvinus Collegium an Einfluss gewinnt und die Wissenschaftsfreiheit bedroht. STEFAAN VAN DER JEUGHT betont, dass Wissenschaftsfreiheit untrennbar mit Sprache verbunden ist, und fragt sich deshalb, inwieweit sie auch das Recht auf Wahl der Unterrichtssprache schützt. OLGA CERAN greift ein ähnliches Thema auf: Da die Unterrichtssprache in europäischen Hochschulen zunehmend umstritten ist, analysiert sie, wie vergleichende Rechtsbetrachtungen die Auslegung von Artikel 13 GRC prägen könnten. In einem weiteren Beitrag kritisiert OLGA CERAN, dass es der EU nach wie vor an einem systematischen Ansatz zur Wissenschaftsfreiheit fehle, der auch deren demokratische Dimension umfasst.
Versammeln und forschen Sie also für den demokratisch gesicherten Frieden, damit er lange währt. Alternative (z.B. bei schlechtem Wetter): Freuen Sie sich, dass Sie es zumindest könnten.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.