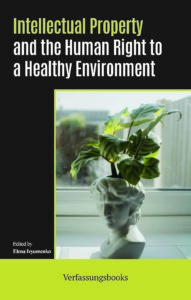„Wir dürfen niemals die Hoffnung auf die Zukunft verlieren“
Fünf Fragen an Michael O’Flaherty
In dieser Woche ist die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) fünfundsiebzig Jahre alt geworden. Ein guter Moment, um diese Errungenschaft zu reflektieren – ein Vertrag, der das Leben Hunderter Millionen Menschen über drei Viertel eines Jahrhunderts geprägt hat.
Doch es sind keine einfachen Zeiten für die Menschenrechte. Wir haben mit Michael O’Flaherty, dem Menschenrechtskommissar des Europarats, darüber gesprochen, was die Konvention nachhaltig bewirkt hat, welchen Herausforderungen sie heute gegenübersteht und warum junge Menschen den universellen Anspruch der Menschenrechte nicht aus den Augen verlieren dürfen – die Vision einer Welt, die frei und gleich an Würde und Rechten ist.
Während wir sprechen, trifft sich die italienische Ministerpräsidentin mit mehreren angeblich gleichgesinnten europäischen Regierungschefs, um darüber zu beraten, wie sich die Reichweite der EMRK einschränken lässt – insbesondere ihre Auslegung als „lebendiges Instrument“. Dem sogenannten „Mai-Brief“, in dem neun europäische Regierungschefs eine offene Debatte zur Auslegung der EMRK forderten, soll im Oktober ein erster Entwurf einer Erklärung gefolgt sein, der genau diese Auslegungsfreiheit begrenzen will. Im Mittelpunkt steht dabei offenbar die Migrationspolitik – genauer: die erleichterte Abschiebung von Migrant*innen, denen Straftaten vorgeworfen werden.
Viele werten das als Zeichen dafür, dass die Konvention zunehmend unter Druck gerät – manche sprechen sogar von einem folgenschweren Umbruch im europäischen Menschenrechtsschutz. Ist das viel Lärm um nichts oder teilen Sie diese Sorge?
Danke für die Frage. Wenn ich darf, würde ich lieber nicht mit Treffen in Rom oder dem Brief der Neun beginnen, denn wir feiern gerade das 75-jährige Bestehen der Konvention – und das sollten wir zum Anlass nehmen, diesen außerordentlichen Erfolg zu würdigen, der teilweise als eine der größten Errungenschaften der Moderne bezeichnet wird. Die Konvention hat unser Leben und unsere Gesellschaften nachhaltig geprägt, oft im Stillen – was ihr manchmal zum Nachteil gereicht.
Es gibt jedoch auch einen ganz anderen Blickwinkel auf die Konvention: all das, was dank ihr nicht schiefgeht, weil sie fest in Recht, Praxis und Rechtsprechung verankert ist. Millionen Menschen erfahren ein besseres Leben durch die Konvention. Ich bin ein schwuler Mann; mein heutiges Leben als Ire wäre ohne die Entscheidungen Norris und Dudgeon unvorstellbar. Das ist für mich persönlich bedeutsam, aber ebenso für alle Menschen, die unter dem Dayton-Abkommen in Bosnien und Herzegowina leben, oder in Nordirland, wo das Belfast/Good Friday Agreement gilt. Die Konvention spielt für ihr Leben eine entscheidende Rolle. Hierin offenbart sich die wahre Tragweite dieses Instruments.
Wir sollten der Konvention daher mit großem Respekt und ebenso großer Sorgfalt begegnen. Genau darum bereiten mir die jüngsten Initiativen und dieser Brief solche Sorgen. Ich möchte nicht einmal von „Brief“ sprechen – schließlich ist das Schreiben an niemanden adressiert. Dieses Dokument, veröffentlicht vor ein paar Monaten von neun Staaten, genauso wie die Berichte über das Treffen in Rom, sind aus meiner Sicht logisch nicht nachvollziehbar. Stattdessen sehe ich, wie sich sehr viel Desinformation über Migration verbreitet. Zugleich werden die Konvention und die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu einer Art Stellvertreter-Arena gemacht, angeblich um diese anderen Probleme zu lösen. Doch der Versuch, die Migrationsfrage über die Konvention zu lösen, wird scheitern. Selbst wenn man noch so sehr an der Konvention und an der Praxis des Gerichtshofs herumdoktert – auf Migrationsbewegungen wird das keinen Einfluss haben.
++++++++++Advertisement++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
Weltweit beobachten wir zunehmend strategische Bemühungen, internationale Institutionen zu schwächen und das internationale Recht auszuhöhlen. Sind die europäischen Menschenrechtsinstitutionen stark genug, um dem standzuhalten? Oder muss Europas regionales Menschenrechtssystem gestärkt werden und es bedarf institutioneller Reformen oder einer entschlosseneren politischen Rückendeckung seitens der Mitgliedstaaten? Welche Bündnisse, Strategien oder konkreten Gegenmaßnahmen sehen Sie als Menschenrechtskommissar, um dieser Entwicklung wirksam entgegenzuwirken?
Ich würde der Behauptung widersprechen, dass wir es mit einer weltweiten Bewegung zur Aushöhlung des Völkerrechts zu tun haben. Ja, es gibt bedauerliche Aussagen, Stimmen und politische Entwicklungen in verschiedenen Ländern. Aber ich sehe keinen globalen Trend, der darauf abzielt, alle Errungenschaften rückgängig zu machen. Wir sollten das Bild also nicht so schwarzmalen, dass wir schon resignieren, bevor wir überhaupt begonnen haben.
Müssen wir das System verändern? Ich glaube nicht. Es gibt immer Raum, menschenrechtliche Kontrollmechanismen zu verbessern und Gerichtsurteile besser durchzusetzen. Das steht außer Frage. Wir können das Bekenntnis zu den Menschenrechten in Gesetzgebung, Politik und Praxis weiter stärken.
Und ehrlich gesagt wäre jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt für institutionelle Neuerungen. Was wir jetzt stattdessen brauchen, ist politische Führung – von Politiker*innen, die der Demokratie verschrieben sind, echter Demokratie, einer Demokratie, die auf Menschenrechten beruht. Manche nennen das „liberale Demokratie“, aber ich bin kein Politikwissenschaftler und möchte mich nicht an Begriffen aufhängen. Wir brauchen Menschen, denen unsere Gesellschaften am Herzen liegen und die Regelwerke verinnerlicht haben, die sie tragen – Menschen, die bereit sind, aufzuwachen und die dringend notwendige politische Führung zu übernehmen. Darum geht es jetzt.
Gestern jährte sich die Unterzeichnung der EMRK zum 75. Mal. Ein Grund zum Feiern, aber auch ein Moment, um innezuhalten und kritisch zu reflektieren. Die Konvention und der Gerichtshof haben vieles erreicht, doch in einigen Staaten ist ihre Wirkkraft in den letzten Jahren fragiler geworden. Welche Lehren können wir aus Fällen wie Russland ziehen oder aus schleichenden Autokratisierungsprozessen in anderen Staaten? Und wie erklären wir den zunehmenden Toleranzverlust gegenüber der EMRK auch in westlichen Demokratien?
Lassen Sie mich mit Russland beginnen: Aus einem autokratischen, despotischen System, das immer weiter Menschenrechte missachtet, lässt sich nicht mehr viel lernen. Es ist zu spät – der Rechtsstaat ist untergraben, Menschenrechte werden verletzt, die Gewaltenteilung ist abgeschafft. Insofern lässt sich aus dem Niedergang eines Regimes – ich sage bewusst „Regime“, nicht „Land“ – wie das der Russischen Föderation kaum etwas lernen, außer vielleicht, dass man sehr viel früher und mit deutlich mehr Entschlossenheit und Kreativität die demokratischen Kräfte in solchen Gesellschaften unterstützen und stärken muss.
Aber um auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen: Kritik an Menschenrechtsnormen oder Institutionen ist legitim, solange sie faktenbasiert bleibt. Leider ist die Debatte über die Konvention derzeit durch Fehl- und Desinformationen geprägt. Sie stützt sich auf teils absurde Annahmen – und lassen Sie mich das deutlich sagen: auf Eindrücke, die bewusst erzeugt, verstärkt und weiterverbreitet wurden: Etwa die Vorstellung, Migrant*innen verdienten weniger Menschenrechtsschutz, es gebe eine besonders hohe Kriminalitätsrate in migrantischen Communities, und man könne Straftäter*innen aus diesen Gruppen nicht abschieben. Keine dieser Behauptungen ist haltbar.
Und zur Klarstellung: Ich fordere keineswegs „offene Grenzen“, sondern lediglich die Einhaltung des internationalen Rechts – insbesondere die Achtung des Non-Refoulement-Grundsatzes sowie des Rechts, einen Asylantrag zu stellen. Nicht mehr und nicht weniger.
Faktenbasierte Kritik ist erwünscht, muss aber bestimmte rote Linien respektieren, die für Menschenrechte und Demokratie essenziell sind. Eine dieser Linien ist die Unabhängigkeit der Gerichte.
Also ja, lassen Sie uns über Urteile streiten und diskutieren. Wir dürfen sie kritisieren, natürlich. Aber wir müssen die Autonomie und Würde dieser Entscheidungen anerkennen und die Diskussion so führen, dass sie Richter*innen hilft, darüber nachzudenken, was künftig vielleicht anders gemacht werden könnte. Eine gesunde Kritik an Institutionen und Gerichten ist nicht nur erlaubt, sie ist notwendig – solange sie auf Fakten beruht und die grundlegenden roten Linien respektiert.
Und wir sollten uns stets bewusst sein, dass das System der Menschenrechtsverträge – sei es auf UN-Ebene, die ich sehr gut kenne, oder das europäische System– ein gemeinschaftliches Versprechen ist: ein Versprechen der Vertragsstaaten, Menschenrechte innerhalb dieser Gemeinschaft zu schützen. Wir müssen aufpassen, dass selektives Herauspicken einzelner Elemente dieses Grundprinzip und damit das System als Ganzes nicht gefährdet – jene Triebfeder, die das System trägt und zusammenhält.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Damit wir 2026 weitermachen können
Wir stellen fundierte juristische Analysen frei zur Verfügung – gerade dann, wenn die Demokratie sie am dringendsten braucht. 3.600 Autor:innen. 9.500 Beiträge. Fast fünf Millionen Aufrufe im letzten Jahr.
Unabhängig. Open Access. Spendenfinanziert. Wir zählen auf Sie, damit es so bleibt.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Lassen Sie uns auf einen Bereich blicken, in dem viele einen schnelleren Fortschritt erwartet hatten: das Verhältnis zwischen der EMRK und der Europäischen Union. Der EuGH lehnte den Beitritt der EU zur Konvention 2014 in seinem Gutachten 2/13 ab – und steht nun erneut vor einer ganz ähnlichen Aufgabe.
Lässt sich das Verhältnis zwischen EMRK und EU zutreffend als ein Ringen zweier Akteure um die Vorherrschaft beschreiben? Wenn nicht – wie erklären Sie, dass ein Kompromiss bislang ausgeblieben ist, den es für eine gemeinsame Stärkung des Menschenrechtsschutzes bräuchte? Der Ball liegt wieder beim EuGH: Wie schätzen Sie die nächsten Schritte ein, und worin liegt Ihrer Ansicht nach das eigentliche Hindernis für den EU-Beitritt zur Konvention?
Ich blicke dem Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention mit großer Hoffnung entgegen – aus mehreren Gründen. Einer davon ist, dass ich selbst für die EU gearbeitet habe. Ich war Direktor der EU-Grundrechteagentur, ich kenne das System also von innen. Und ich habe immer wieder gesehen, wie wertvoll es wäre, eine menschenrechtliche Referenz zu haben, die nicht aus dem System selbst stammt, also nicht aus der „EU-Säule“. Es würde eine unabhängige, externe Instanz geben, deren Überprüfungsleistung für die Einhaltung von Menschenrechten innerhalb der EU sehr hilfreich wäre. Daran glaube ich weiterhin fest.
Die EU hat in Sachen Menschenrechte viel erreicht, muss jedoch ihr Selbstverständnis als globale Akteurin weiterentwickeln und darf sich nicht ausschließlich auf sich selbst beziehen – das gilt auch für ihre Rechtsprechung. Ein Beitritt wäre eine Bereicherung, so wie auch unsere nationalen Gerichte enorm davon profitiert haben, dass sowohl der EuGH als auch der EGMR Teil unserer Rechtsordnung sind. Für die EU wäre das nicht anders.
Ganz grundsätzlich würde ich einen Beitritt begrüßen, weil er für mehr Kohärenz im Menschenrechtsschutz auf dem europäischen Kontinent sorgen würde. Er würde helfen, die meines Erachtens künstliche Trennung zwischen den „Grundrechten“ der EU und den „Menschenrechten“ des Europarats zu überwinden. Und wir sollten dabei nicht vergessen, dass wir alle auch zum Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen gehören.
Mehr Komplementarität, mehr gegenseitige Bezugnahme und Verständnis zwischen diesen Rechtsordnungen würde es einfacher machen, Menschenrechte für alle, die in unseren Staaten leben, einzufordern. Aus all diesen Gründen werde ich mich weiterhin aktiv für den Beitritt einsetzen.
Warum der Beitritt trotzdem stockt? Sie sprachen von „Akteuren“. Ich würde nicht sagen, dass hier um Macht gerungen wird. Eher geht es darum, die jeweiligen Institutionen zu schützen – was völlig legitim ist. Die Gerichte beider Systeme tragen Verantwortung für den ihnen anvertrauten Rechtsbestand. Ich zweifle keine Sekunde an ihrer Integrität, auch nicht an der des Europäischen Gerichtshofs.
Aber dieser Prozess ist eben ein schwieriger, steiniger Weg – wie das Aushandeln einer Ehe, die beide Partner respektiert. Und deshalb geht es langsam voran. Für mich ist es frustrierend langsam, aber es bewegt sich etwas.
Ich war wirklich froh, dass die Verhandlungen nach langer Pause wieder aufgenommen wurden. Nun liegt die Sache erneut beim Europäischen Gerichtshof. Ich würde nicht spekulieren, wie er entscheiden wird, aber ich hoffe sehr, dass das Ergebnis uns dem näher bringt, was ich als diese „Ehe“ bezeichne.
++++++++++Anzeige++++++++++++
The ICJ’s Advisory Opinion on Climate Change
Edited by Maria Antonia Tigre, Maxim Bönnemann, and Antoine De Spiegeleir
Verfassungsbooks, Forthcoming 2025
The International Court of Justice’s Advisory Opinion on the obligations of States in relation to climate change marks the most consequential development in international climate law since the adoption of the Paris Agreement. Bringing together leading voices in international and climate law, this volume examines how the Opinion may reshape the future architecture of global climate governance.
+++++++++++++++++++++++++++
Viele junge Menschen, die heute Völkerrecht studieren, kämpfen mit der Kluft zwischen dem, was in den (Gesetzes-)Büchern steht, und der Realität vor Ort. Kürzlich verglich ein Leitartikel auf unserem Blog die Arbeit internationaler Jurist*innen mit der von Sisyphos – der unermüdlich einen Stein den Berg hochrollt, nur um ihn wieder herunterrollen zu sehen. Was würden Sie Studierenden und jungen Forschenden in diesem Bereich sagen? Wie können sie sich ihre Hoffnung und Überzeugung bewahren?
Eine sehr gute Frage, die ich gut nachvollziehen kann und oft höre. Ich spreche mit vielen jungen Menschen und erfahre dabei ihren berechtigten Widerstand. Fragen wie: Wie kann man für Menschenrechte eintreten, wenn unsere Länder den Genozid in Gaza dulden? Wie kann man von Menschenrechten sprechen, wenn unsere Staaten tatenlos zusehen, während im Sudan unvorstellbare Grausamkeiten geschehen? Wie kann man Menschenrechte verteidigen, wenn darüber diskutiert wird, Russland im Kontext der Ukraine einen ausgehandelten „Kompromiss“ zuzugestehen?
All diese Fragen sind vollkommen legitim. Aber bitte: Wir dürfen die Menschenrechte nicht auf dem Altar unserer tiefen politischen Enttäuschung opfern. Wir dürfen niemals zulassen, dass politische Entscheidungsträger*innen – und mit welchem Recht eigentlich? – die Menschenrechte gewissermaßen für sich beanspruchen, sodass ihre Versäumnisse, ihre Kompromisse und ihre Schwächen dazu führen, dass dieser große zivilisatorische Fortschritt entwertet oder aufgegeben wird.
Wir müssen weiter an die Menschenrechte glauben – als den einzigen weltweit anerkannten Weg, um menschliche Würde zu verwirklichen. Diese Würde, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist. Darin liegt eine der großen Errungenschaften der Europäischen Menschenrechtskonvention: Sie gibt dieser Erklärung eine rechtliche Form. Wie könnten wir überhaupt an eine bessere Zukunft denken, geschweige denn sie gestalten, ohne gleichzeitig an eine Welt zu glauben, in der alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten sind?
Ich erlebe bei jeder Begegnung mit jungen Menschen, dass sie genau an diese Vision weiterhin glauben. Unsere Aufgabe ist es, sie darin zu bestärken, sie zu unterstützen und sie auf diesem Weg zu begleiten.
Und was Sisyphos betrifft: Albert Camus gab ihm eine neue Deutung. Für ihn steht Sisyphos nicht für Hoffnungslosigkeit, sondern für unermüdliche Anstrengung. Camus sagt: Wir dürfen niemals aufhören, an die Möglichkeit einer Zukunft zu glauben – denn wenn wir die Hoffnung auf eine Zukunft aufgeben, gibt es keine.
In diesem Sinne werde ich mich weiter für Menschenrechte einsetzen – und ich werde junge Menschen immer wieder dazu einladen, dies gemeinsam mit mir zu tun: an eine Zukunft zu glauben, die anders sein kann, auch wenn sie sich nur unter größter Anstrengung erreichen lässt.
*
Editor’s Pick
von MAXIMILIAN STEINBEIS
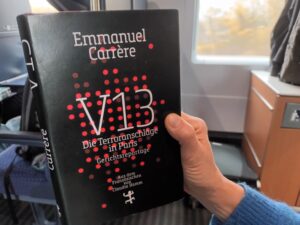
Bataclan, Le Carillon, La Belle Équipe, Petit Cambodge, Stade de France: Am 13. November jähren sich die Terroranschläge von Paris zum zehnten Mal. Den Tätern, soweit sie noch lebten, wurde 2021/22 der Prozess gemacht, neun Monate lang, und dass unter denen, die Tag für Tag hingingen und sich diese minutiöse Rekonstruktion eines unerträglich grässlichen Geschehens von der ersten bis zur letzten Minute antaten, ein großer Schriftsteller war, der daraus ein großes Buch gemacht hat, ist ein großes Glück: So wird man als Leser*in dieses Prozesses teilhaftig, der das unerträglich Grässliche kein bisschen weniger grässlich, aber doch ein ganzes Stück weniger unerträglich macht. Mit dem Verbrechen fertig werden. Seinem Spuk ein Ende bereiten. Das ist es, was der Rechtsstaat kann. Sich daran zu erinnern, mit diesem Buch in der Hand, ist nicht die schlechteste Art, diesen Jahrestag zu begehen.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
Nicht nur die EMRK ist ein „living instrument“ (und bleibt es hoffentlich noch lange). Im Grunde ist das eine schöne Metapher für alle rechtlichen Konstrukte. Wir schleifen und feilen und ölen sie, bis sie ein Eigenleben entwickeln, mit eigenen „Organen“. Und wie alles Lebendige haben auch solche Instrumente ein paar existenzielle Grundbedürfnisse.
Dazu gehört Geld. Für die Kommunen haben die Oberbürgermeister*innen von 13 Landeshauptstädten in einem Brandbrief nun in aller Deutlichkeit daran erinnert. Sie fordern eine „Neujustierung der Grundsätze der kommunalen Finanzausstattung“, weil ihnen gerade das Wasser bis zum Halse steht. Warum hierfür auch ein strukturelles Verfassungsproblem verantwortlich ist, zeigt KYRILL-ALEXANDER SCHWARZ (DE).
Geld schneidet natürlich auch dem Bundesgesetzgeber oft die Luft ab. Hinzu kommt nun noch der Kampf mit einem anderen Bedürfnis, nämlich dem nach Harmonie (oder sagen wir: Konsistenz). Nachdem das BVerfG in seinem Triage-Beschluss 2021 „dem Gesetzgeber“ eine Verletzung seiner Schutzpflichten für Menschen mit Behinderung attestierte, hat es die Triage-Regelungen des IfSG nun für verfassungswidrig erklärt: Dem Bund fehle es bereits an der Gesetzgebungskompetenz. THORSTEN KINGREEN (DE) zeigt sich von dieser „Schutzpflicht mit 16 Adressaten“ wenig überzeugt: Schwerer könne man es dem Gesetzgeber nicht machen.
Harmonischer zeigte sich das BVerfG dagegen bei seiner Egenberger-Entscheidung, die wir schon letzte Woche ausführlich besprochen haben (alle Beiträge finden Sie in unserem neuen Spotlight). Das BVerfG stellt europarechtsfreundlich klar, dass Kirchen nicht für sämtliche Beschäftigte – vom Priester bis zum Gärtner – eine Kirchenmitgliedschaft verlangen können. MATTHIAS MAHLMANN (EN) sieht darin einen begrüßenswerten und gut begründeten Kurswechsel.
Auch dank der Gärtnerei des BVerwG ist das lebendige Grundgesetz ein kleines Stück gewachsen. Im COMPACT-Verfahren stand das Gericht vor der Frage, wie mit „hybriden“ Akteuren umzugehen ist, die als Verein verfassungsfeindliche Zielsetzungen verfolgen und zugleich Presseerzeugnisse verbreiten. In seiner Entscheidung gibt das BVerwG der Meinungs- und Pressefreiheit einen Raum, den diese im Vereinsverbotsrecht bisher nicht hatte. Doch SANDRA LUKOSEK (DE) kritisiert, das Gericht habe diesen Raum nicht konsequent vermessen und ausgeleuchtet – andernfalls hätte es das Verbot wohl aufrechterhalten können.
++++++++++Advertisement++++++++++++
Intellectual Property and the Human Right to a Healthy Environment
Edited by Elena Izyumenko
“This book presents a set of eclectic views centred on the themes of the right to a healthy environment, climate change, clothing upcycling and intellectual property law. The intersection of these legal norms highlights the challenges of reconciling intellectual property law with the human right to a healthy environment. Each chapter is written in an easy to digest style that makes it a good reference point for students and scholars.”
– Ian Fry, Australian National University, Former UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Climate Change (2022–2023)
++++++++++++++++++++++++++++++++
Mit einer wohl verfassungsfeindlichen Vereinigung hatte auch das Arbeitsgericht Braunschweig zu tun. Das AfD-nahe „Zentrum“ forderte Zugang zu einem VW-Betrieb, blieb vor Gericht aber erfolglos. Für DANIEL WEIDMANN (DE) kein Grund zur Entwarnung: In den Betriebsratsgremien könnten rechtsextreme Betriebsratsmitglieder viel Schaden anrichten – auch wenn das „Zentrum“ nie von einem Arbeitsgericht als Gewerkschaft anerkannt werden sollte.
Die AfD selbst setzte sich lange für die Wehrpflicht ein, nur um jüngst eine Kehrtwende zu vollziehen. Ein plötzlicher Sinneswandel? Wohl kaum – dahinter steckt Kalkül, meint FABIAN ENDEMANN (DE): Die Opposition ermögliche der AfD, das Schreckgespenst eines drohenden Unrechtsstaats an die Wand zu malen, der Wehrpflichtige in einen „fremden Krieg“ treibt.
Schreckgespenster malt auch Frankreich an die Wand, allen voran das der Migration, und rechtfertigt damit Rechtsverletzungen. Am 16. Oktober veröffentlichte der Ausschuss für die Rechte des Kindes nun einen Bericht, in dem er Frankreich für die Verletzung der Rechte unbegleiteter minderjähriger Migrant*innen verantwortlich macht. JASPER KROMMENDIJK und LINA SOPHIE MÖLLER (EN) nehmen das zum Anlass, um zu analysieren, wie nationale Gerichte auf die nicht bindenden Feststellungen von UN-Vertragsorganen reagieren – und was dies für den Schutz der Kinderrechte bedeutet.
Währenddessen hat Mexiko es mit echten, schrecklichen Gespenstern zu tun: Bei der Praxis des Verschwindenlassens bleiben die Verschwundenen zwischen Leben und Tod gefangen, in einem für die Angehörigen unaushaltbaren Zwischenreich. Nun hat der mexikanische Ausschuss gegen das Verschwindenlassen zum ersten Mal Notfallmaßnahmen ausgelöst. RODOLFO GONZÁLEZ ESPINOSA (EN) sieht Mexiko am Scheideweg: Wird die internationale Aufmerksamkeit zu echten Reformen führen oder sich die tief verwurzelte Straflosigkeit durchsetzen?
Manchmal erkennen lebendige Instrumente tatsächlich lebendige Wesen nicht als solche an. So entschied der EuGH in Iberia, dass ein bei einem internationalen Flug verlorenes Begleittier als „Gepäck“ im Sinne des Montrealer Übereinkommens gilt. MARINE LERCIER (EN) kritisiert, wie der EuGH Hunde faktisch zu verlorenen Koffern erklärt – und so die soziale Realität der Mensch-Tier-Beziehung verkenne.
Zum Leben gehört auch der Tod. Mit Catarina de Albuquerque ist am 7. Oktober 2025 die „Mutter“ der Menschenrechte auf Wasser und Sanitärversorgung verstorben. In einem berührenden Nachruf würdigt PIERRE THIELBÖRGER (EN) ihr außergewöhnliches Lebenswerk und ihren Einfluss auf eine ganze Generation.
Catarina de Albuquerque widmete ihr Leben dem Lebensnotwendigen – und erinnert uns daran, dass dies eine gemeinschaftliche Aufgabe ist: der Schutz und Erhalt alles Lebendigen, mit oder ohne living instruments.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.