Israel nach dem Waffenstillstand
Warum die Regierung den Rechtsstaat angreift
Zwei Jahre nach Kriegsbeginn markieren sowohl die Waffenruhe in Gaza als auch die Verabschiedung der UN-Sicherheitsratsresolution 2803 einen Wendepunkt. In Israel und weit darüber hinaus hoffen viele nun auf den Beginn einer neuen Ära – auch wenn noch ungewiss ist, wie diese konkret aussehen wird.
Gleichzeitig aber mischen sich in Israel zur Erleichterung über das Ende der Kämpfe und die Rückkehr der Geiseln auch ernsthafte Sorgen über die nächsten Schritte der Regierung Netanjahu. Die Waffenruhe wurde dem Premierminister de facto aufgezwungen, was zahlreiche ultrarechte Koalitionspartner enttäuschte: Ihre Visionen von einem „endgültigen Sieg“ und neuen Siedlungen in Gaza sind damit vom Tisch. Entsprechend groß war die Befürchtung, die Regierung könnte ihre Angriffe auf rechtsstaatliche Strukturen im Inneren weiter verschärfen – wohl auch, um die eigene Basis zu beschwichtigen und davon abzulenken, dass die USA faktisch die Kontrolle über den Gaza-Konflikt übernommen haben. Leider haben sich diese Sorgen bereits als mehr als berechtigt erwiesen.
Vor allem das Parlament, die sogenannte Knesset, steht derzeit im Mittelpunkt heftiger Angriffe. Die Regierung forciert die Verabschiedung von Gesetzen, die fundamentale demokratische Grundprinzipien untergraben. Ein Entwurf nimmt etwa gezielt NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen ins Visier. Ein anderer will durch eine radikale „Restrukturierung“ die wesentlichen Befugnisse der Generalstaatsanwältin beschneiden, sodass diese nicht mehr in der Lage wäre, die Rechtmäßigkeit von Regierungshandeln zu überprüfen. Gleichzeitig unterstützt die Regierung ein Gesetz zur Ausweitung der Todesstrafe bei Terrorismusdelikten, vorangetrieben vom frisch ernannten Leiter des Inlandsgeheimdienstes.
Der politische Druck, die Generalstaatsanwältin aus dem Amt zu drängen, wirkt auch in den aktuellen Ermittlungen gegen die Militärgeneralstaatsanwältin. Auslöser war ein Video, das mutmaßliche Misshandlungen eines Gefangenen durch Soldaten im Militärstützpunkt Sde Teiman zeigt. Medienberichten zufolge wird das Büro der Militärgeneralstaatsanwältin beschuldigt, das Video absichtlich geleakt zu haben, um öffentliche Unterstützung für die Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen zu mobilisieren – und anschließend eine falsche eidesstattliche Erklärung zur Untersuchung des Leaks abgegeben zu haben.
Diese Vorwürfe boten der Regierung einen willkommenen Vorwand für eine breit angelegte Kampagne: gegen die Militärgeneralstaatsanwältin selbst, der vorgeworfen wurde, IDF-Soldaten zu „verleumden“, gegen die Legitimität der Untersuchungen mutmaßlicher Kriegsverbrechen, gegen das Justizsystem insgesamt und ganz gezielt gegen die Generalstaatsanwältin.
So erklärte etwa Verteidigungsminister Katz bei der Ernennung eines neuen Militärgeneralstaatsanwalts, dessen vorrangige Aufgabe bestehe darin, „IDF-Soldaten zu schützen, die unter schwierigen Bedingungen tapfer für die Sicherheit Israels kämpfen – und ganz gewiss nicht darin, an Blutverleumdungen mitzuwirken, die Soldaten diffamieren, ihre Würde verletzen und sie weltweit Verfolgung aussetzen“. Da mehrere Minister die Ermittlungen im Fall Sde Teiman als manipuliert darstellen und ein zentraler Zeuge im Zuge des Geiselabkommens nach Gaza zurückgebracht wurde, scheinen reale juristische Konsequenzen für die dort begangenen Misshandlungen derzeit in weiter Ferne.
++++++++++Advertisement++++++++++++

Das Justiz-Projekt: Verwundbarkeit und Resilienz der dritten Gewalt.
Friedrich Zillessen, Anna-Mira Brandau, Lennart Laude (Hrsg.)
Wie verwundbar ist die unabhängige und unparteiische Justiz? Wo lässt sich Sand in das Getriebe der Justiz streuen? Welche Hebel haben autoritäre Populisten, Einfluss zu nehmen, Abhängigkeiten zu erzeugen, Schwachstellen auszunutzen?
In rund 70 Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus der Praxis haben wir untersucht, welche Szenarien denkbar sind – und was sie für die Justiz bedeuten könnten. Unsere Erkenntnisse veröffentlichen wir nun in „Das Justiz-Projekt. Verwundbarkeit & Resilienz der dritten Gewalt”.
Verfügbar ab dem 2. Dezember, hier auf dem Verfassungsblog – wie immer: Open Access!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Die Folgen der Sde-Teiman-Affäre reichen jedoch weit über den ursprünglichen Fall hinaus. In sozialen Netzwerken kursierten Spekulationen, auch die Generalstaatsanwältin könne in den Vorfall verwickelt sein. Minister Ben Gvir befeuerte diese Gerüchte zusätzlich, indem er behauptete, „sicher“ zu sein, dass Daten vom Telefon der Militärgeneralstaatsanwältin die Generalstaatsanwältin belasten würden – Belege dafür liegen bis heute nicht vor. Die enge institutionelle Verzahnung zwischen Militärgeneralstaatsanwaltschaft und dem Büro der Generalstaatsanwältin führte außerdem zu Streitigkeiten darüber, welche staatliche Stelle die Ermittlungen begleiten sollte. Justizminister Levin nutzte die Gelegenheit, um den Konflikt mit der Generalstaatsanwältin und dem Obersten Gerichtshof weiter zu verschärfen. All dies ereignete sich vor dem Hintergrund des Korruptionsprozesses gegen Netanjahu selbst, der zwar langsam, aber stetig voranschreitet.
Noch deutlicher zeigt sich die Erosion des Rechtsstaats auf der Straße. Die Gewalt extremistischer Siedler im Westjordanland hat massiv zugenommen, und das israelische Militär scheint zunehmend die Kontrolle darüber zu verlieren. Anhörungen vor dem Obersten Gerichtshof werden regelmäßig gestört – teils sogar von Knesset-Mitgliedern. Ein von MK Almog Cohen angeführter Mob stürmte an der Ben-Gurion-Universität die Informatikvorlesung einer Dozentin, die sich außerhalb des Unterrichts kritisch über die IDF geäußert hatte. Führende Vertreter der Protestbewegung sehen sich immer häufiger Schikanen von rechtsgerichteten Aktivisten und der Polizei ausgesetzt.
Die internationale Öffentlichkeit konzentriert sich – zu Recht – vor allem auf das Geschehen in Gaza. Doch jede politische Initiative, die Israel als verlässlichen Partner voraussetzt, bedarf einer Regierung, die ihre – auch internationalen – Verpflichtungen ernst nimmt. Eine, die sich nicht darauf einlässt, die radikalsten Flügel ihrer eigenen Wählerschaft um jeden Preis ruhigzustellen.
2026 ist Wahljahr in Israel, für Ende Oktober sind Neuwahlen angesetzt. Bereits jetzt prägt die Aussicht darauf das Handeln der Regierung spürbar – sowohl durch ihren Drang, vorab möglichst viele Gesetze zu verabschieden, als auch durch den Versuch, die politischen Rahmenbedingungen zu ihren Gunsten zu gestalten. Dementsprechend ist zu erwarten, dass die Regierung weiterhin gezielt jene Institutionen und Akteure angreifen wird, die sie als Hindernisse wahrnimmt – von der Generalstaatsanwältin über politische Gegner bis hin zu den Köpfen der Protestbewegung und den freien Medien.
Ob diese Institutionen und Personen diesen Angriffen standhalten, wird entscheidend sein – für faire Wahlen, einen möglichen Regierungswechsel und letztlich für die Zukunft Israels sowie der gesamten Region.
*
Editor’s Pick
von MARGARITA IOV
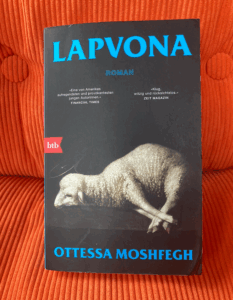
Lange habe ich kein so radikales zeitgenössisches Buch gelesen wie Ottessa Moshfeghs Lapvona. Der Roman spielt im mittelalterlichen Dorf Lapvona, das unter der Willkürherrschaft des Fürsten Villiam liegt. Die Welt ist grausam und schlicht: Marek, der missgebildete Sohn des Lammhirten, lebt in Armut, Gewalt und Gottesfurcht. Helden gibt es keine, aber an Bösewichten mangelt es nicht: Mareks gewalttätiger Vater, der vergnügungssüchtige, dümmliche Villiam und auch Marek selbst, der aus primitiver Eifersucht Villiams Sohn ermordet und schließlich dessen Platz in der Burg einnimmt – eine romangewordene Hieronymus-Bosch-Hölle.
Doch dieses Kabinett der Grausamkeiten ist nur Kulisse für ein viel größeres Verbrechen: Sobald die Dorfbewohner über die hohen Abgaben klagen, fallen raubmordende Banditen über sie her – für die Bewohner eine göttliche Strafe, aber in Wahrheit hat Villiam sie geschickt. Genauso ist die entsetzliche Dürre, die über Lapvona hereinfällt, keine göttliche Plage. Man fragt sich: Warum lassen diese bemitleidenswerten Bauern das mit sich machen? Und ganz schnell ist man wieder bei uns – den bemitleidenswerten Bewohnern des 21. Jahrhunderts.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
Angesichts von Krieg und Friedensplänen stellt sich auch Deutschland die Frage: Was passiert eigentlich, wenn die Bundesrepublik angegriffen wird oder ein solcher Angriff droht? Verfassungsrechtlich gilt: Damit der Bundestag den Verteidigungsfall feststellen kann, muss eine 2/3-Mehrheit zustimmen. Das könnte an den Linken oder der AfD scheitern. MORITZ VON ROCHOW (DE) zeigt, unter welchen Voraussetzungen der Bundestag dazu verpflichtet wäre.
Vergangenen Sonntag hat Chile gewählt. Wer Präsident wird, entscheidet sich offiziell bei der Stichwahl am 14. Dezember. Doch viele halten die Wahl schon für entschieden: Alles deute darauf hin, dass José Antonio Kast von der rechtsextremen Partei Republicanos Chiles nächster Präsident wird. RODRIGO KAUFMANN (EN) untersucht, was eine mögliche Kast-Regierung bedeuten könnte: entweder ein Law-and-Order-Regime à la Bukele – oder massive Straßenproteste gegen Sparmaßnahmen, so seine Prognose.
Währenddessen beschäftigt sich Großbritannien mit Protesten abseits der Straßen: Denn dort sind es zunehmend die Privatwohnungen von Politiker*innen, die zum Schauplatz von Demonstrationen werden. 2015 fuhr die Modedesignerin Vivienne Westwood mit einem Panzer bis zu Camerons Haustor, um gegen Fracking zu demonstrieren; 2023 belagerte Greenpeace Rishi Sunaks Haus, und zuletzt versammelte sich Youth Demand bei Keir Starmers Zuhause, um gegen dessen Haltung im Israel-Gaza-Konflikt zu protestieren. Ein geänderter „Crime and Policing Bill“ soll’s nun richten und solche Proteste unter Strafe stellen. Zwar sei das Schutzanliegen wichtig, doch NATHAN WHETTON (DE) zweifelt daran, ob der Entwurf mit der Versammlungsfreiheit aus Artikel 11 EMRK vereinbar ist.
Forum shopping gibt es nicht nur bei Versammlungen, sondern anscheinend auch beim Referendariat. Nachdem er in Rheinland-Pfalz scheiterte, darf ein rechter Aktivist – trotz seiner rechtsextremen Vergangenheit – den juristischen Vorbereitungsdienst in Sachsen antreten, wie das OVG Sachsen nun entschied. SIMON MÜLLER (DE) geht mit diesem sächsischen Sonderweg hart ins Gericht und warnt vor den Konsequenzen.
Auch beim Grundrechtsschutz scheint fleißig geshoppt zu werden: Die Europäische Kommission will die Digitalregulierung grundlegend und so schnell wie möglich – per Omnibus – überarbeiten. Der Entwurf wurde letzte Woche geleakt. HANNAH RUSCHEMEIER (EN) analysiert die geplanten Änderungen und zeigt sich besorgt: Sollte er durchgehen, würde der Omnibus die Grundpfeiler des Datenschutzrechts überrollen.
Und auch sonst war in der EU einiges los. Letzte Woche debattierte der LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments über den Vorschlag der Kommission für eine Rückführungsverordnung. Ziel ist es, die Rückführungsquote der EU zu erhöhen und Migrant*innen in sogenannten Rückkehrzentren in Drittstaaten außerhalb der EU unterbringen zu können. GIANNA ECKERT (EN) erklärt, warum solche Rückkehrzentren die Rückführungsquoten kaum erhöhen werden – aber sicher die Menschenrechte von Migrant*innen untergraben.
Außerdem veröffentlichte die Europäische Kommission das lang erwartete European Democracy Shield. FRANCA MARIA FEISEL (EN) begrüßt zwar den neuen Bottom-up, sog. „whole of society“-Ansatz, warnt jedoch, dass die Bedrohungen nicht nur von außen kämen und es an konkreten Umsetzungsschritten fehle.
Sollten Sie nicht nur diesen Newsletter, sondern auch – Gott bewahre – soziale Medien konsumieren, wurde Ihr Feed sicherlich bereits mit KI-generiertem „Content“ geschwemmt. Singende Hunde usw., Sie wissen schon. Was unterhaltsam sein soll, gefällt der Unterhaltungsindustrie ganz und gar nicht (von der Umwelt mal abgesehen). Wie generative KI urheberrechtlich geschütztes Material nutzen darf, zählt weltweit zu den meistdiskutierten Fragen des Urheberrechts. Nun hat das LG München der Klage der deutschen Verwertungsgesellschaft GEMA gegen OpenAI stattgegeben und die Frage damit als erstes Gericht in der EU entschieden – mit bestechender Einfachheit, finden LINDA KUSCHEL und DARIUS ROSTAM (DE/EN).
Thematisch verwandt ging diese Woche schließlich unser Symposium „Enabling Access, Fostering Innovation: Towards a Digital Knowledge Agenda in Europe“ (EN) zu Ende. TERESA NOBRE argumentiert, dass die EU mit einem Digital Knowledge Act ihre Wissensinstitutionen endlich angemessen in die Digitalstrategie einbinden könnte.
Text- und Data-Mining sind zwar vom EU-Urheberrecht ausgenommen, jedoch nur für Werke, auf die Forschende „rechtmäßigen Zugriff“ haben. Doch dieses Kriterium wird laut TATIANA-ELENI SYNODINOU und GIORGOS VRAKAS zu eng ausgelegt.
Wie eng auch immer man „rechtmäßigen Zugriff“ auslegen möchte – unser Blog wird immer reinpassen. Wir bleiben open access, mit Ihrer Hilfe.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.



