Der Kampf gegen Gender-Apartheid
Hoffnung durch Rechenschaft
Vier Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban verschwindet Afghanistan zunehmend aus der öffentlichen Debatte – in Europa wie weltweit. Einer der wenigen verbleibenden Wege, sich mit den Frauen Afghanistans solidarisch zu zeigen und die Hoffnung auf Veränderung am Leben zu halten, ist internationale Verantwortlichkeit. Für Millionen afghanischer Frauen und Mädchen, deren Träume und Ambitionen durch die Taliban-Verbote von Bildung, Arbeit, Bewegungsfreiheit und Zugang zur Justiz zunichtegemacht wurden, sind völkerrechtliche Konsequenzen die letzte Hoffnung. Ansätze, die Taliban vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zur Verantwortung zu ziehen, ein mögliches Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) oder die Initiative zur Kodifizierung von Gender-Apartheid sind wichtige Schritte. Doch sie müssen intensiviert werden, um ernsthaften Wandel anzustoßen.
Im September 2024 erklärten vier Staaten – Deutschland, Australien, Kanada und die Niederlande –, dass sie rechtliche Schritte einleiten wollen, um die Taliban für Verstöße gegen das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) völkerrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Afghanische Frauenrechtsgruppen und die internationale Menschenrechtsgemeinschaft begrüßten diesen Schritt, äußerten aber auch Besorgnis und legten weitere Empfehlungen vor: Sie forderten sicheren und ernsthaften Austausch mit den betroffenen Gemeinschaften innerhalb und außerhalb Afghanistans, wirkliche Teilhabe und Transparenz im Verfahren sowie eine breite internationale Rückendeckung, auch durch Staaten des Globalen Südens und mehrheitlich muslimische Länder. Ein Jahr später warten afghanische Frauen und Menschenrechtsverteidigerinnen noch immer auf konkrete Fortschritte. Während die Taliban ihre Repressionen verschärfen, deutet zugleich vieles auf eine beunruhigende Normalisierung ihres Regimes in der Region und darüber hinaus hin. So unterläuft Deutschlands Praxis, Afghan*innen abzuschieben und hierfür „technische Kontakte“ zu den Taliban zu nutzen, das gegebene Schutzversprechen und den Geist der CEDAW-Initiative.
Im August 2025 jährte sich die illegale und gewaltsame Machtübernahme der Taliban zum vierten Mal. In dieser Zeit ist es ihnen gelungen, ihre Vision eines religiös-autoritären Unterdrückungssystems durchzusetzen. Frauen und Mädchen sind vom Zugang zu Bildung, Arbeit und Bewegungsfreiheit ausgeschlossen. Gesichter und Stimmen von Frauen sind in den Medien verboten; ihnen wird der Zutritt zu Parks, Museen, Restaurants, Sportstätten und selbst zu Frauensalons verweigert. Diese Unterdrückung trifft auch Kinder: Schon Mädchen ab neun Jahren riskieren Strafen wegen ihrer Kleidung und werden vom Schulbesuch ausgeschlossen. Weil eine koordinierte internationale Reaktion ausbleibt, verankern die Taliban ihre Verbote zunehmend in repressiven Gesetzen und greifen selbst die wenigen Ausnahmeräume an, etwa die Arbeit weiblichen UN-Personals. Zuletzt wurde diesen der Zugang zu ihren Büros verweigert, woraufhin das UNHCR seine Arbeit einstellen musste – ein weiterer Schlag gegen die Rechte von Frauen und das Völkerrecht.
++++++++++Anzeige++++++++++++

IE University is seeking to appoint 4 tenure-track Assistant Professors in Law. The call is open to all fields of legal expertise. We are looking for candidates with the potential to develop a strong record of high-impact publications and to achieve excellence in teaching. With campuses in Madrid and Segovia (Spain), IE University is a member of the CIVICA research alliance, The Law Schools Global League, the European Law Faculties Association, and the Center for Transnational Legal Studies. If you want to join our vibrant and international faculty, apply by October 31, 2025 through this link.
++++++++++++++++++++++++++++
Afghanische Frauen beschreiben dieses System seit Langem als „Gender-Apartheid“. Die diskriminierenden und unterdrückenden Maßnahmen der Taliban sind systematisch, institutionalisiert und Kernbestandteil ihrer Herrschaft. In ihrer Weltsicht sind Frauen und Mädchen Männern und Jungen untergeordnet. Schulen, Universitäten und Medien dienen ihnen als Werkzeuge zur Durchsetzung dieser Ideologie. Ende 2024 hatten die Taliban bereits 130 Edikte erlassen, die sich direkt gegen Frauen richten. Mit dem Gesetz zur „Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters“, das im August 2024 in Kraft trat, wurde schließlich die Auslöschung von Frauen aus dem öffentlichen Leben kodifiziert.
Meine Organisation Rawadari dokumentiert die Umsetzung dieses Gesetzes und seine Folgen für die Gesellschaft. Eine junge, entfernte Verwandte, Nargis (Name geändert), arbeitete als Hebamme in abgelegenen Regionen Südafghanistans, wo sie für Frauen und Neugeborene lebenswichtige medizinische Hilfe leistete. Ungeachtet von Angst und Einschränkungen blieb sie nach der Machtübernahme der Taliban im Land und setzte ihre Arbeit fort, auch wenn das bedeutete, sich stärker verhüllen zu müssen und nur noch in Begleitung eines männlichen Verwandten reisen zu dürfen. Nebenbei studierte sie Medizin. Doch nach Inkrafttreten des Gesetzes im August 2024 und der Schließung medizinischer Ausbildungsgänge für Frauen im Dezember desselben Jahres sah sie keinen Ausweg mehr und floh Anfang 2025 nach Pakistan. Dort lebt sie nun allein, arbeitslos und von Abschiebung bedroht – ohne ihre Beschäftigung, ihre Gemeinschaft, rechtlichen Schutz und ihre Heimat. Afghanistan hat damit eine engagierte, erfahrene Hebamme verloren. Ihr Schicksal ist eine von tausenden erschütternden Geschichten aus Afghanistans Gender-Apartheid.
Die Taliban bestrafen mithilfe ihrer Institutionen – allen voran dem Geheimdienst und dem Ministerium für die „Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters“ – jeden Widerstand durch unrechtmäßige Haft, Verschleppung und Folter. Unabhängige Medien und zivilgesellschaftliche Freiräume werden von ihnen eingeschränkt, während sie mit tausenden neu gegründeten Madrassas eine neue Generation von Anhängern heranziehen. Gleichzeitig gewinnen sie diplomatisch an Boden, zuletzt mit der offiziellen Anerkennung ihres Regimes durch Russland im Juli 2025.
Für die Frauen in Afghanistan zeichnet sich eine düstere Zukunft ab, und die Welt scheint dem gleichgültig gegenüberzustehen. Internationales Handeln ist vor diesem Hintergrund mehr als Symbolik – es ist existenziell. Es bekämpft eine Kultur der Straflosigkeit, kann weitere Verbrechen eindämmen und erhält die Hoffnung derjenigen Frauen aufrecht, die unter einem der repressivsten Regime der Welt für ihre Würde und Rechte kämpfen. Alle Bemühungen um Rechenschaft müssen verstärkt werden, um eine Normalisierung der Taliban im In- und Ausland zu verhindern.
Auch Deutschland muss ein Jahr nach Ankündigung der CEDAW-Initiative seinen Worten Taten folgen lassen, zum Beispiel, indem es ein Verfahren vor dem IGH anstößt. Glaubwürdigkeit, Konsequenz und die Verpflichtung zum Völkerrecht verlangen aber auch, dass Deutschland Abschiebungen nach Afghanistan stoppt und sich insbesondere unter Staaten des Globalen Südens und mehrheitlich muslimischen Ländern um umfassende Unterstützung für die Initiative bemüht. Breite Allianzen für das CEDAW-Vorhaben zu schmieden, ist zuletzt auch dadurch erschwert worden, dass Deutschlands Position im Verfahren Südafrika gegen Israel vor dem IGH seinen internationalen Ruf untergraben hat. Ein breites Bündnis von Staaten unterschiedlicher Regionen und politischer Prägungen würde ein deutliches Signal an die Taliban senden, die stärker auf die Positionen regionaler muslimischer Staaten achten. Deutschland muss nun beweisen, dass es diese Initiative ernst nimmt und nicht lediglich als symbolische Geste oder Druckmittel für Abschiebungen nutzt.
++++++++++Anzeige++++++++++++

Postdoctoral Research Assistant in European Climate Rights
The Department of Law, Aarhus University, is seeking to appoint a postdoctoral research assistant to work on the exciting project “The Emergence of European Climate Rights” funded by the Independent Research Fund Denmark. The project runs for 24 months and is led by Professor Ole W. Pedersen, the Principal Investigator. For more information, please click here.
++++++++++++++++++++++++++++
Die CEDAW-Initiative ist aber nur ein Teil der laufenden Bemühungen, Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan aufzuarbeiten, und ergänzt andere wichtige Ansätze. Die Kampagne afghanischer Frauen zur völkerrechtlichen Anerkennung von Gender-Apartheid ist ein Teil davon. Amnesty International, Human Rights Watch und der UN-Sonderberichterstatter zur Menschenrechtslage in Afghanistan haben diese Forderung befürwortet und mitgetragen. Nun ist es an Deutschland, dasselbe zu tun. Der aktuell diskutierte Vertrag über Verbrechen gegen die Menschlichkeit bietet die Gelegenheit, diese Lücke im Völkerrecht zu schließen und Frauenrechte zu schützen. Deutschland sollte sich an die Seite der afghanischen Aktivistinnen sowie Überlebenden stellen und auf die rechtliche Verankerung von Gender-Apartheid im Rechtsrahmen des IStGH-Statuts drängen.
Im Juli 2025 erließ der IStGH Haftbefehle gegen zwei Taliban-Führer – ein bislang seltener Schritt, um nach Jahrzehnten der Straflosigkeit in Afghanistan Rechenschaft einzufordern. Deutschland und andere Staaten müssen das Mandat des Gerichtshofs unterstützen, um die Taliban für geschlechtsspezifische Verfolgung verantwortlich zu machen und von weiteren Verbrechen abzuschrecken. Zudem fordern afghanische Menschenrechtsorganisationen seit Langem einen unabhängigen, internationalen Rechenschafts-Mechanismus für Afghanistan, der zur Aufarbeitung vergangener wie aktueller Verbrechen beiträgt. Eine solche Einrichtung – idealerweise in der laufenden Sitzung des UN-Menschenrechtsrats geschaffen – könnte die Arbeit eines IGH-Verfahrens, die Ermittlungen des IStGH und Verfahren auf Grundlage universeller Gerichtsbarkeit maßgeblich unterstützen, indem sie verlässliche Dokumentationen und Beweise bereitstellt.
Afghanische Frauen und Menschenrechtsverteidigerinnen geben nicht auf. Neben Appellen an die Staaten haben sie selbst gehandelt und das People’s Tribunal for Women of Afghanistan in Kooperation mit dem Permanenten Völkertribunal ins Leben gerufen. Dieses Tribunal soll Überlebenden mit einem „Tag vor Gericht“ eine Plattform bieten, um die systematische geschlechtsspezifische Verfolgung durch die Taliban darzustellen und sichtbar zu machen sowie zugleich neue Solidarität und Unterstützung für Afghanistans Frauen zu mobilisieren. Im Oktober finden in Madrid die Anhörungen statt, bei denen Afghaninnen erneut ein umfassendes Vorgehen einfordern werden, einschließlich konkreter Schritte bei der CEDAW-Initiative.
Während afghanische Frauen unter den Bedingungen der Gender-Apartheid trotz Unterdrückung, Gefahr und Verzweiflung für Hoffnung und Freiheit kämpfen, müssen sich Deutschland und die Welt diesem Kampf anschließen. Gerade in einer Zeit, in der mächtige Staaten das Völkerrecht und die Menschenrechte angreifen, sollte Deutschland nicht seine Versprechen brechen und damit sowohl seine eigene Glaubwürdigkeit unterlaufen als auch die Taliban stärken, sondern seinen Kurs ändern und für Rechenschaft eintreten.
*
Editor’s Pick
von MARIE MÜLLER-ELMAU
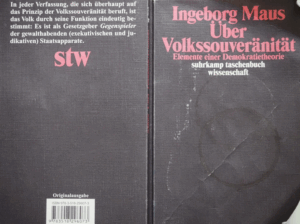
Ingeborg Maus hat als politische Theoretikerin vieles schon gedacht, bevor politische Theoretiker es taten. Zum Beispiel, dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie als Ideale theoretisch nicht vereinfacht gegeneinander stehen – hier die Parlamente, die Gesetze erlassen, dort Gerichte, die Grenzen setzen – sondern notwendig miteinander verschränkt sind. Parlamente verfassen Recht, und adressieren damit Gerichte und Verwaltung, die es um- und durchsetzen. Ingeborg Maus zu lesen, lohnt schon deshalb, weil sie mit gnadenlosem Scharfsinn dort Verschränkungen offenlegt, wo andere Binaritäten vermuten; und weil sie Prämissen, Verflechtungen und Konsequenzen von Demokratietheorien ausleuchtet, die auch aktuelle politische Krisendiagnosen erhellen und präzisieren. Vor knapp einem Jahr ist sie verstorben. Mein Pick also: mehr Ingeborg Maus lesen, diskutieren, und weitersagen.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von CHARLOTTE HERBERT
„Gaza brennt”, verkündete Israels Verteidigungsminister Katz gerade auf der Plattform „X”. Bereits im August äußerte sich Katz derart drastisch in Bezug auf die bevorstehende Offensive in Gaza, dass über 20 israelische Völkerrechtler:innen in einem Brief vor schwersten Völkerrechtsverletzungen warnten. Katz’ Erklärung lasse die Absicht erkennen, „eindeutig rechtswidrige Handlungen durchzuführen, die für alle Beteiligten strafrechtliche Verantwortung sowohl nach internationalem als auch nach israelischem Recht nach sich ziehen können. In der Tat können diese Worte als ein Signal für die vollständige Aufgabe der grundlegenden Prinzipien des humanitären Völkerrechts und sogar der eigenen Werte der IDF verstanden werden.” Das Dokument ist nur eines von zahlreichen Memoranden und Briefen, in denen sich israelische Völkerrechtler:innen zum Krieg in Gaza äußern. Im Juli haben wir die bislang größtenteils unveröffentlichten Dokumente bei uns zur Verfügung gestellt, eingeleitet, systematisch aufgearbeitet und nun frisch aktualisiert von KAI AMBOS (EN).
Auch außerhalb Israels und Palästinas bewegt der Krieg in Gaza zwar weiterhin die Rechtswissenschaften. Offen und klar über den Krieg sprechen zu können, ist jedoch nicht in allen akademischen Kontexten eine Selbstverständlichkeit. Über die komplexen Mechanismen von Zensur und Selbstzensur haben ANNA SOPHIA TIEDEKE und JEAN D’ASPREMONT (EN) miteinander gesprochen.
Weniger wird in Zukunft dagegen wohl von Jair Bolsonaro zu hören sein. In einem aufsehenerregenden Prozess wurde Brasiliens ehemaliger Präsident und Beinahe-Putschist zu 27 Jahren Haft verurteilt. EVANDRO PROENÇA SÜSSEKIND (EN) sieht darin zwar ein starkes Lehrstück im Kampf gegen autoritären Populismus. Für eine echte Immunisierung gegen dessen Gefahren müsse sich Brasilien jedoch mit seinem militärischen Erbe auseinandersetzen.
In den USA hat Donald Trump die US Navy am 2. und erneut am 15. September angewiesen, kleine Schnellboote in der Karibik zu zerstören. In beiden Fällen kamen alle Menschen an Bord ums Leben. Internationale Jurist:innen kritisieren die Tötungen als rechtswidrig. Auch MARY ELLEN O’CONNELL (EN)wertet dies als Trumps bisher gefährlichsten Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit.
Zu kentern droht auch die Unabhängigkeit der thailändischen Justiz. Dort hat das VerfassungsgerichtPaetongtarn Shinawatra ihres Amtes als Premierministerin enthoben. Sie wird als „unethisch“ bezeichnet. Für KHEMTHONG TONSAKULRUNGRUANG (EN) ist dieses Urteil ein weiteres Zeichen für das Eindringen der Justiz in die Politik in Thailand.
Für Unstimmigkeiten zwischen Justiz und Politik könnte in der Europäischen Union bald das EU-Mercosur-Abkommen sorgen. Mitglieder des Europäischen Parlaments erwägen, den EuGH um ein Gutachten zur Vereinbarkeit des Abkommens mit dem EU-Recht zu ersuchen. Im Zentrum stehen dabei mögliche Verstöße gegen die internationalen wie regionalen Klimaschutzpflichten der EU. CHRISTINA ECKES (EN) begrüßt die Idee und erklärt, warum das Abkommen tatsächlich den Klimaschutz unterlaufen könnte.
Unvereinbar mit EU-Recht sei es auch, die neue SAFE-Verordnung auf Art. 122 AEUV zu stützen, meint MATTIS LESON (EN). Die Verordnung soll eine Reaktion auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen nach dem russischen Angriffskrieg sein, werte die Norm aber zu einer Generalklausel auf, die tiefgreifende Veränderungen ohne parlamentarische Beteiligung ermögliche.
MARIA SKÓRA (EN) untersucht die jüngste Entscheidung des EuGH zu Polens Justiz. Da es sich bei der Kammer für außerordentliche Überprüfung und öffentliche Angelegenheiten am polnischen Obersten Gericht mangels Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht um ein Gericht handelt, müssen nationale Gerichte deren Entscheidungen als nicht existent ansehen.
Ähnlichen Problemen sieht sich Frankreich zwar nicht ausgesetzt. Doch die Institutionen der Fünften Republik gerieten zuletzt in anderer Hinsicht immer stärker unter Druck. Nachdem François Bayrou die Vertrauensfrage verlor, übernahm Sébastien Lecornu als Premierminister. Warum Frankreichs politische Krise damit nicht zu Ende ist und welche Aufgaben Lecornu nun bevorstehen, zeigt GIOVANNI CAPOCCIA (EN).
Bundeskanzler Merz will hart über Sozialstaatsreformen debattieren und auch die Kinder- und Jugendhilfen kürzen. BASTIAN BASSE (DE) erklärt, warum die Erziehungshilfen demokratische Übungsräume sind – und warum Kürzungen haushaltspolitisch nicht angezeigt, demokratiepolitisch kurzsichtig und rechtsstaatlich riskant wären.
Nicht nur riskant, sondern glatt verfassungswidrig sei dagegen der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), meint ANNE-MARLEN ENGLER (DE).Geflüchtete sollen unter bestimmten Umständen Aufnahmeeinrichtungen für bis zu ein Jahr nicht mehr verlassen dürfen – das sei nicht nur eine Freiheitsbeschränkung, sondern ein unzulässiger Freiheitsentzug.
Zweifel an der Verfassungstreue stellten sich unlängst in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dort wurden zwei AfD-Bürgermeisterkandidaten nicht zur Wahl zugelassen; beide Ausschlüsse wurden nun gerichtlich bestätigt. ANDREAS NITSCHKE (DE) hält die Entscheidungen im Ergebnis für nachvollziehbar. Sie verdeutlichen jedoch, dass die Wahlausschüsse bei der Prüfung der Verfassungstreue von Bewerbern vor einer Wahl mit einer Aufgabe konfrontiert sind, deren rechtssichere Bewältigung Ressourcen braucht, die nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden können.
Eine Reaktion auf Matthias Frehes Text der vergangenen Woche, der für ein Grabenwahlrecht plädierte, liefert FABIAN MICHL (DE). Auch bei einer Grabenwahl wären die Wähler:innen letztlich mit denselben Alternativen konfrontiert wie bisher – der Auswahl zwischen Parteien. Wer nicht nur eine Partei, sondern auch deren Personal im Parlament wählen wolle, brauche dafür kein Grabenwahlrecht, sondern lediglich das Parteibuch – das lasse sich auch leichter beschaffen.
Wie steht es eigentlich um die Medienfreiheit in der EU? Schlecht, resümiert ZUZANNA NOWICKA (EN). Ein Hoffnungsschimmer sei jedoch das Anfang August in Kraft getretene Europäische Medienfreiheitsgesetz, das Transparenz, redaktionelle Unabhängigkeit und konkrete Pflichten für private Unternehmen vorsehe. Artikel 3 gewähre sogar ein durchsetzbares Recht auf unabhängige Medien, sodass Verstöße gegen den Medienpluralismus nun vor nationalen Gerichten angefochten werden könnten.
Von der Medienfreiheit ist es nur ein kleiner Schritt zu einer Frage, die uns in Zukunft wohl noch viel stärker beschäftigen wird: Wie viel menschliche Kontrolle braucht es im Zeitalter von KI (noch)? SEBASTIAN SCHWEMER und IDA KOIVISTO (EN) diskutieren, ob Mechanismen in EU-Regulierungen, die menschliche Interventionsmöglichkeiten erhalten sollen, wirklich als Sicherheitsmechanismen dienen – oder inzwischen vor allem symbolischen Charakter haben.
Den Bogen zwischen Medien, KI und Wissenschaft spannt schließlich MICHAEL GRÜNBERGER (DE), und erklärt in einem viel beachteten Text, warum er eine KI-Vertragsergänzung des Beck-Verlags nicht unterschreibt. Die Klauseln seien aus urheberrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher und wissenschaftstheoretischer Perspektive problematisch. Auch anderen Wissenschaftler:innen rät Grünberger: lieber nicht unterschreiben.
Zum Abschluss werfen wir wieder mal einen Blick nach oben – ins All: JASPER TRETOW (DE) untersucht den Vorschlag der EU-Kommission für den „EU Space Act“ und warnt, dass die pauschalen Ausnahmen für die militärische Nutzung von „Weltraumobjekten“ Kohärenz und Effektivität der Verordnung schwächen. Der Vorschlag ist zwar bereits aus dem Juni, doch wie meine Kollegin sagt: „Macht nichts, das All ist 13 Milliarden Jahre alt und wird es noch ein bisschen länger geben.“
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.



