Auf dem Friedhof des Völkerrechts
Von Straußen, Eulen und Oktopussen
„Gaza wird zum Friedhof des Völkerrechts.“ So formulierte es der palästinensische Menschenrechtsanwalt Raji Sourani letzten Oktober gegenüber dem Guardian. Seit Trumps Rückkehr ist diese Diagnose noch viel klarer worden. Flucht, Klima, Gesundheit und Welthandel – die Pfeiler der Völkerrechtsordnung bröckeln. In diesem Editorial möchte ich über eine Frage nachdenken, die viele von uns umtreibt: Was bedeutet dieser Zerfall internationaler Normen für Völkerrechtler*innen?
Der Berufsstand hat sich grob in zwei Lager aufgeteilt. Auf der einen Seite stehen die Strauße: Jurist*innen, die ihren Kopf – teilweise bewusst – tief in den völkerrechtlichen Sand stecken (und zu denen ich mich manchmal selbst zähle). Strauße halten an den Normen fest, die das lange 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Sie scheinen zu hoffen, dass die liberale regelbasierte Ordnung noch zu retten ist. Sie schreiben, dokumentieren und klagen stoisch weiter. Ihre Hoffnung: Wenn sie nur geduldig und juristisch genau weiterarbeiten, wird irgendwo irgendwann ein Gericht Recht sprechen: ein Urteil, eine Wiedergutmachung, ein Wendepunkt der Geschichte.
Dahinter steht der Instinkt der Kontinuität – gelassen und entschlossen einfach weiterzumachen, trotz der Katastrophe. Der Strauß appelliert: „Wir sind Experten. So lautet das Recht. Es muss befolgt werden!“ Für diese Haltung gibt es gute normative Gründe: Vor allem wehren sich Strauße dagegen, dass der Regelbruch mit der Entstehung neuer Regeln einhergeht, die den Interessen der Mächtigeren dienen. Doch das Leben als Strauß birgt ein Risiko: Er verpflichtet sich der „richtigen Seite“ einer Zukunft, die niemals kommen wird. Und währenddessen steht immer irgendwo die nächste Konferenz an.
Auf der anderen Seite stehen die Eulen – eine seltenere, aber dennoch präsente Spezies. Sie blicken mit Altersweisheit und geschichtlichem Spott auf die Institutionen des 20. Jahrhunderts: längst verfallen, sagen sie, nur die Ruinen stehen noch. Sie wissen, dass das Völkerrecht neu erfunden werden muss. Die USA sind keine globale Hegemonialmacht mehr. China hat diese Rolle bislang nicht übernommen. Die Weltmärkte sind labil, und der Geist der künstlichen Intelligenz ist aus der Flasche. Doch die Eulen warten lieber auf das Morgengrauen, ehe sie losfliegen.
Eulen denken spekulativ. Selten haben sie Antworten auf aktuelle Probleme. Und wenn, dann träumen sie von der normativen Kraft der Technologie, von vergessenen indigenen Rechtstraditionen, den Rechten der Natur oder rechtsfähigen Objekten – Träume, die sich noch weniger durchsetzen lassen als das ohnehin durchsetzungsschwache klassische Völkerrecht.
Auch für die Haltung der Eule gibt es gute normative Gründe. Vor allem: Eulen richten keinen Schaden an. Auch ich finde mich manchmal in diesem Lager wieder. Aber das Eulenleben läuft Gefahr, zu einem ästhetischen Projekt zu verkommen – ein Gedankenspiel, von dem nicht klar ist, wie es sich zur Realität verhält. Kaum, dass wir eine Alternative imaginiert – oder zu Abend gegessen – haben, ist Gaza verhungert und der Wald abgebrannt.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Im Oktober 2022 erhält die Menschenrechtsorganisation Memorial den Friedensnobelpreis. Noch am selben Tag wird die Beschlagnahmung des Büros in Moskau angeordnet. Nach der Razzia prangt überall auf Materialien und Möbeln der Buchstabe «Z»: ein Mahnmal. Der Welt ist das Netzwerk Memorial durch seine beispiellose Aufklärungsarbeit bekannt, Moskau jedoch sieht in ihm vor allem eins: Einen Störfaktor, den es auszuschalten gilt. Es ist nicht der erste Angriff auf das Gedächtnis der Nation, den die Organisation erlebt und abwehrt. Hier präsentiert sie die Chronik ihrer Kämpfe.
++++++++++++++++++++++++++++
Ein Abgesang auf die liberale Weltordnung
Omar El Akkads neues Buch „One Day, Everyone Will Have Always Been Against This“ (2025) macht dieses Dilemma spürbar. El Akkad beschreibt, wie er von seinem Wohnzimmer in Portland aus dem Völkermord zusieht – auf seinem Smartphone, während seine Kinder nebenan spielen.
Es ist eine tief verstörende, zugleich aber auch vertraute Szene: Während der Autor die Kinder ins Bett bringt oder den Hund füttert, sieht er anderen Kindern beim Sterben zu – und Hunden, wie sie Leichen fressen. Mit jeder Seite wird klarer, dass El Akkads Weltbild – das Versprechen des Westens der 1990er-Jahre – in Echtzeit zerfällt. Ich vermute, vielen Völkerrechtler*innen geht es ähnlich; diese Desillusionierung ergänzt in meiner Generation den Zusammenbruch der Disziplin um eine biographische Dimension. Bei allem Respekt für Strauße und Eulen – viele von uns fühlen sich in deren Gefieder nicht wohl.
El Akkad ist in Ägypten, Katar und Kanada aufgewachsen. Wie viele Migrant*innen hat auch ihn das kulturelle Versprechen des Liberalismus geprägt. Der Westen versprach nicht nur Wohlstand, sondern Sinn: Freiheit, Gleichheit, Würde. Doch als Biden darauf bestand, weiterhin Waffen an Israel zu liefern, wurde El Akkad schmerzhaft klar: Das Versprechen der liberalen Weltordnung war eine Lüge, von Anfang an. El Akkad möchte sich vom US-amerikanischen Liberalismus abwenden, doch wohin er gehen kann – und ob es überhaupt einen anderen Ort gibt – ist unklar.
Der Titel des Buchs klingt versöhnlich – als würde sich die Geschichte zwangsläufig der Gerechtigkeit beugen. Doch El Akkads Botschaft ist bitter: „Eines Tages wird jeder schon immer dagegen gewesen sein.“ Nicht, weil die Wahrheit ans Licht kam und uns solidarisch machte – sondern weil es dann nichts mehr kostet, dagegen gewesen zu sein. Gaza wird zerstört sein. Und auch beim Klima werden wir, in den Worten von Andreas Malm, feststellen: „Es ist zu spät.“
El Akkads rotes Buch ist eine Anklage – nicht nur gegen die US-Außenpolitik, sondern gegen den gesamten liberalen Rechtsglauben. Für uns Völkerrechtler*innen richtet sich seine Kritik an Strauße wie Eulen. Beide beanspruchen, für internationale Gerechtigkeit zu stehen. Beide verkennen dabei die eigene Verstrickung. Oft treiben uns unser Ego und unsere Karrieren mehr an als das, was wir mit unserer Arbeit in der Realität anrichten.
Der zweite Zusammenbruch
Als Südafrika Anfang 2024 Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermords anklagte, schaute die ganze Welt zu. Eine Post-Apartheid-Regierung erklärte den Richter*innen: Seht, was Israel mit euren Waffen und eurem Geld macht. Wenn die regelbasierte Ordnung irgendetwas bedeutet, dann jetzt. Es war ein historischer Moment, und doch blieb er folgenlos.
Mehr als ein Jahr später ist die Hungersnot in Gaza schlimmer als je zuvor. Dies ist kein „liberaler Völkermord“, den vor allem Leugnung und Verdrängung auszeichnen. Es ist ein offenes Bekenntnis zur Vernichtung. Es ist die gezielte Bombardierung von Schiffen mit Hilfsgütern in internationalen Gewässern, fernab jeder Kampfzone – und kaum jemand nimmt Notiz. Die Masken sind gefallen. Erst letzte Woche verabschiedete das israelische Kabinett einen Plan zur „Eroberung“ Gazas und zur „freiwilligen Ausreise“ der Bevölkerung. Viele blicken nun hoffnungsvoll nach Riad. Trump hat den Nahen Osten jetzt verlassen, und Israels Luftoperationen deutet darauf hin, dass der Plan der ethnischen Säuberung in eine neue Phase eingetreten ist.
Natürlich ist dies nicht der erste Zusammenbruch des Völkerrechts. Der Völkerbund (1920) und der Briand-Kellogg-Pakt (1928) markierten die erste Welle des modernen Internationalismus. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fielen sie Faschismus, Krieg und Völkermord zum Opfer. Die zweite Welle folgte nach 1945: die UN-Charta, die Völkermordkonvention – Institutionen, die aus der Asche jener Zeit entstanden. So wurde auch der Staat Israel mit Hilfe westlicher Supermächte gegründet. Heute zerstört Israel nicht nur palästinensisches Leben, sondern die Regeln selbst. Israel steht dabei keineswegs allein da: Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 – ein weiterer Grundpfeiler der Nachkriegsordnung – wird von westlichen Staaten ausgehöhlt. Wir erleben zweifellos einen zweiten Zusammenbruch.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Das von der Stiftung Mercator geförderte, am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht angesiedelte Center for Diversity in Law unter der Leitung von Max-Planck-Fellow und Lehrstuhlinhaber an der EBS Universität Prof. Dr. Emanuel V. Towfigh sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Das Center dient der empirischen, dogmatischen und rechtsvergleichenden Erforschung von Diversität im Rechtssystem und der Vernetzung von Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft.
++++++++++++++++++++++++++++
Rechtliches Handeln in Zeiten sich formenden Rechts
Wie die Eule weiß, könnte bald eine dritte Phase des Völkerrechts anbrechen, aber noch kann niemand sagen, wie diese aussehen wird. Wie viel Blut wird noch fließen müssen – in der Ukraine, im Sudan, im Kongo? Werden wir überhaupt noch von Recht sprechen, wenn bald autonome Systeme entscheiden?
Wir können nicht länger so tun, als würden wir uns auf sicherem Grund bewegen. Aber wir können auch nicht stehen bleiben. Beweise sichern, Argumente austauschen – das bleibt unser Job. Und es bleibt notwendig, auch wenn wir nicht wissen, an welchem rechtlichen System man unser Handeln eines Tages messen wird. Wir brauchen neue Werkzeuge und neue Denkweisen. Das bedeutet nicht Rückzug, sondern Realismus. Diesem Zeitalter permanenter Polykrisen lässt sich nur begegnen, wenn wir die Regeln anwenden und gleichzeitig das System erneuern. Welches Tier könnte diese dritte Haltung verkörpern? Vielleicht der Oktopus: ernsthaft, aber verspielt, mit einer ganz anderen Art zu denken – eine dezentrale Intelligenz, die als Einheit handelt.
Ein Beispiel für solch ernsthaftes Spiel war Südafrikas Völkermordklage: ein Scheitern vor Gericht, aber ein Weckruf für die internationale Gemeinschaft. Oktopusdenken zeigt sich auch anderswo. Bei den Klimaklagen ebnete etwa das Konzept intergenerationeller Rechte neue Wege, von Urgenda bis zum Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Die Law and Political Economy-Bewegung denkt Investitions- und Handelsrecht neu, um globale Ungleichheit und Ernährungsunsicherheit zu bekämpfen. Diese Ansätze verabschieden sich nicht vom Recht, akzeptieren es aber auch nicht in seiner jetzigen Form – sondern verwandeln es unter Druck.
Oktopusse wenden geltende Regeln an und erfinden das System zugleich neu. Eulen interessieren sich für die Rechte der Natur und die Eigenmacht der Dinge – daraus können neue Denkweisen entstehen: über das Klima, aber auch darüber, wie wir mit unseren Technologien leben. Doch solche Ideen tragen nur dann, wenn sie auf das technische Gespür und die Detailgenauigkeit der Strauße treffen, die jedes Sandkorn einzeln prüfen.
Die Zukunft des Völkerrechts hängt davon ab, den Instinkt zur Kontinuität mit der Energie des Bruchs zu verbinden. Wir können uns nicht für das eine und gegen das andere entscheiden.
*
Editor’s Pick
von EVA MARIA BREDLER
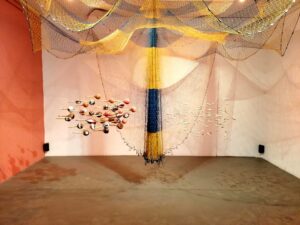
Nach Itamar Manns Taxonomie oben bin ich eine Eule: von neuen Ideen den Kopf verdrehen lassen und dann an der Starrköpfigkeit des geltenden Rechts verzweifeln. So ging es mir auch, als ich Jane Bennett’s „Vibrant Matter – A Political Ecology of Things“ las. Allein der Titel! Wie dieser verrät, geht Bennett (zusammen mit Deleuze, Guattari, Spinoza, Latour u.v.m.) von der Lebendigkeit und Handlungsfähigkeit der Dinge („thing power“) aus und fragt: Wie würde eine Politik aussehen, die ernst nähme, dass wir Menschen nie alleine handeln, sondern als Teil einer „human-non-human-working-group“? Dank Bennett fühlt sich der Schimmel in meiner Wohnung mehr nach experimenteller WG an. Aber fragen Sie mich nicht, was das für meinen Vermieter heißt.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
In der Politik ist nicht selten eine Spezies präsent: Fische, die mit dem politischen Strom schwimmen und ein kurzes Gedächtnis haben. Andere erinnern sich vielleicht: Alexander Dobrindt, nun Bundesminister des Innern und für Heimat, hat als Verkehrsminister die Pkw-Maut vorangetrieben – entgegen allen rechtlichen Bedenken. Das Ende ist bekannt: Der EuGH kassierte die Maut und verurteilte Deutschland zu einem Schadensersatz in Millionenhöhe. Gleicher Fisch, neues Gewässer: Am 7. Mai wies Dobrindt die Bundespolizei an, die Grenzkontrollen zu verschärfen und Schutzsuchende zurückzuweisen. Damit setzt er das Dublin-Verfahren aus – ein „klarer Rechtsbruch“, wie CONSTANTIN HRUSCHKA (DE) erklärt. Und die menschlichen Kosten könnten jeden Schadensersatz übersteigen.
Schadensersatz ist trotzdem wichtig, nur in Asylverfahren schwer zu bekommen. Jetzt verspricht auch noch der Koalitionsvertrag, den Untersuchungs- in einen Beibringungsgrundsatz umzuwandeln. Das ist aus praktischen Gründen kaum machbar, sagt CAROLIN DÖRR (DE).
Denn Kläger*innen haben in Asylverfahren kaum Zugang zu relevanten Beweismitteln. So war es auch in einem Fall, der jetzt den EuGH beschäftigt: Hamoudi gegen Frontex. Wer trägt die Beweislast, die hochtechnologisierte EU-Agentur oder der Asylsuchende auf See? Was die Schlussanträge von Generalanwalt Norkus dazu sagen (sollten), erklärt AGOSTINA PIRRELLO (EN).
Auch andere Schlussanträge haben uns diese Woche wieder beschäftigt, nämlich jene von de la Tour in denen verbundenen Fallen Alace und Canpelli zur Frage, ob und wie EU-Mitgliedstaaten definieren dürfen, welche Länder als „sichere Herkunfts- oder Drittstaaten“ gelten. Laut de la Tour ist „überwiegend sicher“ sicher genug, auch wenn einzelne Gruppen gefährdet sind. Während sich MATILDE ROCCA (EN) letzte Woche auf die menschenrechtlichen Implikationen konzentrierte, widmet sich ADEODATA KANYAMIHANDA(EN) nun der Frage, was „teilweise sicher“ bedeuten kann.
Überraschenderweise wirkt sich auch Trumps Politik darauf aus, welche Länder als „sichere Herkunfts- oder Drittstaaten“ gelten. Vor allem das Defunding im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit verändert die Informationslage zu asylrelevanten Herkunftsländern radikal. LEA HANSEN und SOPHIE ROCHE (DE) zeigen, wie elementar die US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) für Erkenntnismittel war und vor welche Herausforderungen das Ende von USAID die Asylrichter*innen nun stellt.
Staatsbürgerschaft ist nicht nur schwer zu gewinnen, sondern auch leicht zu verlieren. Immer mehr Staaten sehen den Entzug der Staatsbürgerschaft vor, wenn ihre Bürger*innen terroristische Straftaten begehen. Ein Amsterdamer Gericht hat solche Regeln nun als Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft eingeordnet. SANTIAGO DRESEN (EN) erklärt, warum das Gericht hier Diskriminierungskategorien vertauscht habe könnte.
Von einem großzügigeren Entzug der Staatsbürgerschaft scheint laut dem nun geleakten Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz auch die AfD mit ihrem „ethnisch-abstammungsmäßigen“ Volksverständnis zu träumen. Es wurde ausgiebig diskutiert, was die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ nun für Beamt*innen heißt, die auch Mitglied in der AfD sind. Dabei sind die rechtlichen Maßstäbe eigentlich geklärt: Grundsätzlich genügt die alleinige passive Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Partei noch nicht, um eine Verletzung der politischen Treuepflicht zu begründen. Doch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum III. Weg könnte ein erster Schritt sein, davon abzuweichen, wie SOFIANE BENAMOR (DE) beobachtet.
Die AfD-Hochstufung wirft noch allerlei weitere Fragen auf, unter anderem, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk der AfD weiterhin Sendezeit geben sollte. JOHANNES MAURER (DE) gibt Antworten.
Auch der Koalitionsvertrag von Union und SPD ist noch lange nicht entpackt. Diese Woche ging es bei uns um den Nationalen Sicherheitsrat, den die Bundesregierung einrichten will. HEIKO MEIERTÖNS (DE) ordnet die Institution staatsorganisationsrechtlich ein.
Dass der Koalitionsvertrag zur längst fälligen Reform des Abstammungsrechts schweigt, nimmt TERESA FACHINGER (DE) zum Anlass, die verfassungsrechtlichen Vorgaben zusammenzufassen: Es handele sich bei der Reform nicht um eine politische Gefälligkeit ist, sondern um eine verfassungsrechtliche Pflicht.
Im Koalitionsvertrag ist von „Umgang mit Desinformation“ die Rede. Einige wollen darin ein „Lüge-Verbot“ erkennen. SUSANNE BECK und MAXIMILIAN NUSSBAUM (DE) räumen damit auf, was wirklich hinter der Passage steckt und welche Rolle das Strafrecht dabei spielt.
Keine Rolle spielte das Strafrecht letztlich bei den rassistischen Parolen, die Gäste der Pony-Bar letztes Jahr auf Sylt grölten – die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren wegen Volksverhetzung mangels Tatverdachts ein. VINCENT ECKE (DE) sieht das kritisch.
War doch nur Spaß, mögen sich die Gäste der Pony-Bar verteidigt haben. Ein falsches Verständnis von Humor – wie es laut ROMAN ZINIGRAD (EN) der EGMR in Yevstifeyev and others v. Russia leider verkennt und so Hassrede normalisiert.
Diese Woche haben wir ein Symposium zur „Verstetigung von Bürgerräten in Deutschland“ (DE) gestartet, das interdisziplinäre rechtsvergleichende Beiträge zu Form und Ausgestaltung, den Funktionen und der verfassungsrechtlichen Verankerung von Bürgerräten versammelt.
FELIX PETERSEN erläutert im Einleitungstext den Rahmen dieses interdisziplinären Symposiums sowie den Stand der Debatte. MARC ZECCOLA untersucht Legitimations-, Akzeptanz-, Transparenz-, Informations- sowie Qualitätsfunktion bei Bürgerräten. DANIELA WINKLER und KORNELIUS LÖFFLER untersuchen Gemeinsamkeiten zu bestehenden Institutionen und befragen Bürgerräte auf ihre Hybridstellung zwischen Gesellschaft und Staat. KLARA WESTERLAGE argumentiert, dass Bürgerräte mit quasi‑legislativer Entscheidungsgewalt verfassungswidrig wären. PHILIP BERGER behandelt die verfassungstheoretische Zulässigkeit von entscheidungsbefugten Bürgerräten. FRANK BRETTSCHNEIDER untersucht gelungene Kommunikationsbedingungen vor, während und nach der Durchführung von Bürgerräten. POLA BRÜNGER diskutiert die wichtige Frage nach der Beteiligung von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit an Bürgerräten, in Deutschland immerhin 14,1 Mio. Menschen. ANDRÉ BÄCHTIGER, SASKIA GOLDBERG und MARINA LINDELL präsentieren zwei Lesarten einer vergleichenden Studie dazu, wie Bürger:innen über Bürgerräte in Deutschland, den USA, Irland und Finnland denken. CHRISTIAN ERNST und ENNIO FRIEDEMANN zeigen, dass die Idee kommunaler Selbstverwaltung einen größeren Möglichkeitsraum für Bürgerräte öffnet. ARNE PAUTSCH widmet sich dem ständigen Bürgerrat in Ostbelgien, PETER BUßJÄGER dem nationalen Klimarat in Österreich. ANDREAS GLASER analysiert die Situation in der Schweiz.
Außerdem haben wir das Symposium zu „Ongoing Controversies over Methods in EU Law – Towards a Reflexive Turn“ (EN) fortgesetzt. MARCO GOLDONI zeigt, wie eine Law and Political Economy Perspektive die unionsrechtliche Analyse bereichern kann. SIGNE REHLING LARSEN plädiert mit Tocquevilles „Über die Demokratie in Amerika“ dafür, die EU anhand eines vergleichenden Föderalismus zu untersuchen. MORITZ SCHRAMM teilt seine persönlichen Erfahrungen mit halbstrukturierten Expert*inneninterviews. ANTOINE VAUCHEZ erkundet, wie rechtliche Demokratiekonzepte im polarisierten Europa neu definiert werden.AFRODITI MARKETOU bespricht die Ergebnisse einer vergleichenden Studie dazu, wie das Verhältnismäßigkeitsprinzips als Grundsatz des EU-Rechts in Frankreich, England und Griechenland angewandt wird. Und schließlich liest FERNANDA G. NICOLA EuGH-Entscheidungen als „EU Law Stories“.
Love statt law stories wären uns manchmal lieber. Wie vertragen sich eigentlich politische Fische und völkerrechtliche Oktopusse? Um nur eine Geschichte zu erzählen: Der Oktopus Otto aus dem Sea Star Aquarium Coburg wurde bekannt, weil er sein Aquarium regelmäßig umgestaltet hat – unter anderem war er dafür berüchtigt, Steine gegen die Glasscheiben zu werfen, Lampen auszuschalten, indem er gezielt Wasser auf sie spritzte, und andere Tiere im Aquarium zu ärgern. Wir brauchen mehr Oktopusse.
*
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.




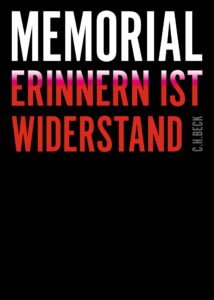

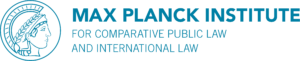
I.M.: „Doch die Eulen warten lieber auf das Morgengrauen, ehe sie losfliegen.“
Eulen sind nachtaktive Vögel. Sie jagen in der Nacht und schlafen am Tag. Deshalb meinte Hegel auch, dass die Eule der Minerva ihren Flug erst mit der einbrechenden Dämmerung beginnt. Ich habe dies immer mit der Abenddämmerung assoziiert und nicht die Morgendämmerung (Morgengrauen). Habe ich Hegel und die Lebensweise der Eulen missverstanden oder die Pointe von I.M. nicht verstanden?
“Das Versprechen der liberalen Weltordnung war eine Lüge, von Anfang an.” Das fühlt sich für mich nicht …richtig an. Schüttet das Kind mit dem …. Sie wissen schon. Man kann auch an Idealen gemessen werden, die man nur behauptet und nicht ernst gemeint hat. Wenn, dann waren/sind die Werte der liberalen Weltordnung zwar Lüge, aber wie Terry Pratchett es TOD erklären lässt: Lügen wie GNADE GERECHTIGKEIT SINN, zur Übung…
Die Idee hinter einer auf Recht basierenden internationalen Ordnung ist es, diejenigen an der Macht zur Verantwortung zu ziehen und dabei Gleichheit und Würde für alle zu wahren. Wenn das System am Ende aber nur die Schwächsten bestraft, wenn sie Verbrechen begehen, während die Stärksten ungestraft davonkommen, dann basiert es nicht wirklich auf Gleichheit oder Würde, sondern ist schlichtweg eine Farce.
Dieses Problem ist nicht neu. Ich empfehle, “Soundtrack of a Coup D’état” anzuschauen. Der Dokumentar Film ist sehr aufschlussreich und zeigt bemerkenswerte Parallelen zu unserer heutigen Zeit.
Ich wünschte, wir wären weniger pedantisch und würden uns stattdessen mehr auf den Kerninhalt und die wichtige Botschaft konzentrieren, die der Autor uns Lesern vermitteln möchte.