Das Gesetz der Gesetzlosigkeit
Zur letzten Sitzungsperiode des US Supreme Courts
Die Sitzungsperiode des US-Supreme Courts ist zu Ende. Sie stand im Zeichen teils verstörender Entwicklungen. Eine der folgenreichsten: Republikanische Richter*innen legitimierten die Delegitimierungskampagne der Trump-Regierung gegenüber den unteren Bundesgerichten – und zwar nicht erst im jüngsten Beschluss in Trump v. CASA. In gleich mehreren Entscheidungen übernahm der Supreme Court die Trump’sche Rhetorik, dass Bundesgerichte, die Bundesrecht gegenüber der Regierung durchsetzen, irgendwie illegitim seien. Nicht das rechtswidrige Verhalten der Exekutive bedrohe demnach die Verfassung, sondern die Entscheidungen der Gerichte, die die Exekutive dabei einschränken.
Trump und seine Regierung haben sich auf ganz unterschiedliche Weise richterlicher Kontrolle widersetzt. Die Delegitimierungskampagne gegen Richter*innen und die Autorität bundesgerichtlicher Entscheidungen stand dabei im Mittelpunkt. Als die Moderatorin Laura Ingraham Trump fragte, ob sich seine Regierung an Gerichtsurteile halte, wechselte er kurzerhand das Thema und lästerte über Richter*innen: „Ich hatte die schlimmsten Richter. Ich hatte korrupte Richter.“ Trump nannte Richter Boasberg, der das erste Verfahren zum Alien Enemies Act entschied, einen „radikal linken Irren“, einen „Unruhestifter und Aufrührer“, der „ANGEKLAGT werden sollte“. In einer Erklärung nach Boasbergs erstem Urteil gegen die Regierung behauptete Justizministerin Pamela Jo Bondi, dass „ein Prozessrichter in DC Tren de Aragua-Terroristen über die Sicherheit der Amerikaner stellt“. Trump deutete an, dass Richter, die gegen ihn urteilten, „korrupt“ sein könnten, und fügte hinzu: „Wir müssen uns die Richter vielleicht anschauen, denn ich denke, das ist ein sehr schwerer Verstoß.“ Trump dämonisierte die Gerichte und stellte sie als Gefahr dar. Er forderte „mutige GERECHTIGKEIT“ und warnte: „Wenn die Gerichte uns nicht mehr erlauben, das zu tun, was uns seit 250 Jahren erlaubt war, kann Amerika nicht mehr dasselbe sein.“
Diese Rhetorik setzte sich auch im Regierungshandeln fort: Die Regierung missachtet Gerichtsentscheidungen ganz offen. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, warf den Medien „Panikmache“ vor, weil sie vor einer möglichen Verfassungskrise warnten, in der die Exekutive sich nicht an Gerichtsentscheidungen hält. Dabei finde der „wahre Verfassungsbruch“ „innerhalb unserer Justiz statt, wo Bezirksrichter in liberalen Bezirken im ganzen Land ihre Macht missbrauchen, um die exekutive Autorität von Präsident Trump einseitig zu blockieren.“ Leavitt nannte einige Urteile der unteren Gerichte gegen die Regierung „verfassungswidrig“ und „unfair“: „Ein Bezirksrichter unterer Instanz kann keine einstweilige Verfügung erlassen, um die exekutive Autorität des Präsidenten auszuhebeln.“ Vizepräsident Vance sagte, es sei „illegal“, wenn ein Richter bestimmte Anweisungen an Exekutivbeamte erteile, da „Richter nicht befugt sind, die legitime Macht der Exekutive zu kontrollieren.“ Auf die Frage von Senatorin Elizabeth Warren, ob er einem hypothetischen Gerichtsurteil eines unteren Gerichts Folge leisten würde, antwortete Verteidigungsminister Pete Hegseth: „Ich glaube nicht, dass Bezirksgerichte die nationale Sicherheitspolitik bestimmen sollten.“ Doch er fügte hinzu: „Wenn der Supreme Court über ein Thema entscheidet, werden wir dies befolgen.“
Und mehr noch: Mehrere Bundesrichter*innen haben festgestellt, dass die Regierung ihre Anordnungen offensichtlich verletzt hat. Die beiden prominentesten Beispiele betreffen das Thema Einwanderung. Im ersten Fall zum Alien Enemies Act weigerte sich die Regierung, Flugzeuge zurückzubeordern, nachdem Richter Boasberg genau das angeordnet hatte (ein aktueller Whistleblower-Bericht legt nahe, dass dies unter anderem auf Anweisung von Emil Bove erfolgte, der inzwischen für das Berufungsgericht des dritten Bezirks nominiert ist). Und nachdem ein Richter der Regierung untersagt hatte, Menschen ohne vorherige Benachrichtigung und Widerspruchsmöglichkeit in nicht benannte Länder abzuschieben, ließ die Regierung einige Männer kurzerhand über Guantanamo Bay nach El Salvador fliegen. Andere sollten nach Libyen abgeschoben werden, und wiederum andere wurden in ein Flugzeug nach Sudan gesetzt – all das ohne auch nur den Anschein eines ordentlichen Verfahrens.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Rechtliche Fragen von morgen schon heute bearbeiten!
3+ Universitätsassistent*innen – Dissertationsstellen
Haben Sie Interesse an einer Dissertation im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Mobilität, Rechtsphilosophie oder Gender und Recht?
Das forschungsstarke Institut für Theorie und Zukunft des Rechts der Universität Innsbruck (Prof. Kettemann, Prof. Kirchmair (ab 1.9.), Ass.-Prof.in Rauchegger und Ass.-Prof.in Voithofer) schreibt zum 15.9.2025 drei Dissertationsstellen aus. Weitere Stellen sollen über Drittmittel finanziert werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 22.7.2025.
Mehr zum Institut finden Sie hier.
Bitte bewerben Sie sich auf alle ausgeschriebenen Stellen zugleich: 15210, 15212, 15213.
++++++++++++++++++++++++++++
Mehrere Angehörige der Trump-Regierung haben vorgeschlagen, Richter*innen der unteren Gerichte ihres Amtes zu entheben, sofern sie gegen die Regierung entscheiden. Einige Republikaner*innen im Kongress haben sich dafür offen gezeigt. Vergangene Woche reichte die Regierung Klage gegen alle 15 Bundesrichter*innen in Maryland ein – Grund war ein Urteil, das die sofortige Abschiebung von Migranten blockierte, die gegen ihre Ausweisung geklagt hatten.
Bundesrichter*innen sehen sich daneben zunehmend Drohungen gegen sich und ihre Familien ausgesetzt. Nachdem die Supreme Court-Richterin Amy Coney Barrett in einer Sache gegen die Trump-Regierung entschieden hatte, ging bei der Familie ihrer Schwester Ziel eine Bombendrohung ein.
All dies bildet den Hintergrund, vor dem die aktuellen Entscheidungen des Supreme Court gelesen werden müssen. Sie ergehen in einem politischen Klima, in dem eine Regierung immer mehr Macht beansprucht und zugleich dagegen ankämpft, dass die Exekutive dem Recht unterworfen ist und Bundesgerichte dieses Recht auch gegenüber der Exekutive durchsetzen dürfen. Indem der Supreme Court sich gerade in solchen Fällen regelmäßig gegen die unteren Gerichte stellt, legitimiert er die Delegitimierungskampagne der Regierung und deren Widerstand gegen die Justiz.
Ein Beispiel: In Trump v. Wilcox erlaubten die republikanischen Richter*innen dem Präsidenten etwas, was den unterinstanzlichen Gerichten untersagt ist – ein Präzedenzurteil des Supreme Court vorwegnehmend außer Kraft zu setzen. Trump entließ die Leiter*innen verschiedener Kommissionen und verletzte dabei Bundesgesetze, die nach dem nahezu hundert Jahre alten Urteil Humphrey’s Executor eindeutig verfassungsgemäß sind. Humphrey’s Executor wird regelmäßig als Leitentscheidung für die verfassungsrechtliche Kompetenz des Kongresses zitiert, solche Abberufungsentscheidungen des Präsidenten einzuschränken. Entsprechend blockierten die unteren Gerichte Trumps Entlassungen mit Verweis auf dieses Urteil. Der Supreme Court dagegen macht regelmäßig deutlich, dass nur er selbst eigene Entscheidungen aufheben darf – auch dann, wenn die Entscheidungen inzwischen als überholt gelten und die unteren Gerichte damit rechnen, dass der Supreme Court die Entscheidung bald revidieren wird. Offenbar steht dieses Recht nun allein dem Präsidenten zu. Wie Richterin Elena Kagan in ihrer abweichenden Meinung zu Wilcox schreibt: „Der amtierende Präsident ist der Ansicht, dass Humphrey’s entweder aufgehoben oder eingeschränkt werden sollte. Und er hat sich entschieden, nach dieser Ansicht zu handeln – also das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen.“ Die Entscheidung des Gerichts, so Kagan weiter, „erlaubt es dem Präsidenten, Humphrey’s per Dekret aufzuheben“, obwohl der Supreme Court andere Gerichte stets daran erinnere, dass bindende Präzedenzfälle anzuwenden seien – das Privileg, diese zu kippen, bleibe dem Supreme Court vorbehalten.
Gleichzeitig gab der Supreme Court dem Antrag der Regierung statt, zwei besonders schwerwiegende Verstöße gegen gerichtliche Anordnungen nachträglich abzusegnen – zum einen die Anordnung, Abschiebeflüge nach dem Alien Enemies Act zu stoppen und bereits gestartete Maschinen zurückzuholen, zum anderen das Verbot, Menschen ohne vorherige Anhörung in Drittstaaten abzuschieben. In ihrer abweichenden Meinung zur third country removal decision schrieb Richterin Sotomayor: „Jedes Mal, wenn dieses Gericht Rechtsbruch mit Ermessensspielraum belohnt, trägt es zur weiteren Erosion des Respekts vor Gerichten und dem Rechtsstaat bei.“ Der Supreme Court hat die Regierung nicht für die Missachtung gerichtlicher Anordnungen verantwortlich gemacht, im Gegenteil: Er hat sie von der Pflicht entbunden, diese Entscheidungen zu befolgen – und damit die Argumentation der Regierung gestärkt, dass die von Anfang an nicht legitim gewesen seien.
++++++++++Anzeige++++++++++++
The European Center for Constitutional And Human Rights in Berlin is seeking a person (gn) with at least two years of relevant professional experience to work in the field of “International Crimes and Accountability.” As part of the four-year project funded by the European Commission “Global Initiative Against Impunity For International Crimes and Serious Human Rights Violations: Making Justice Work,” the position of Project Coordinator is to be filled. We are an independent, non-profit human rights organisation primarily working through legal means. An exciting and challenging job in an internationally active human rights organisation with a worldwide network and numerous benefits are waiting for you!
++++++++++++++++++++++++++++
Erst letzte Nacht gab der Supreme Court dem Antrag der Regierung statt, seine begründunglose Anordnung im Fall der Abschiebung in Drittländer „klarzustellen“. Dabei machte das Gericht deutlich, dass seine frühere Verfügung offenbar so weit gefasst war, dass sie auch die Maßnahme des Bezirksgerichts blockierte. Dieses hatte der Regierung aufgegeben, den Männern – die entgegen einer früheren Gerichtsentscheidung in den Südsudan abgeschoben werden sollten – zumindest den Anschein eines rechtsstaatlichen Verfahrens zu gewähren. Der Supreme Court hielt es jedoch nicht einmal für nötig, zu erklären, warum die ursprüngliche Anordnung der Vorinstanz fehlerhaft gewesen sein soll. In einem scharfen Sondervotum schrieb Richterin Sotomayor: „Die heutige Anordnung stellt nur eines klar: Andere Prozessparteien müssen sich an die Regeln halten, aber die Regierung hat den Obersten Gerichtshof offenbar auf Kurzwahl.“
Gerade vor diesem Hintergrund stößt die Entscheidung des Supreme Court im Fall Trump v. CASA bitter auf. Der Supreme Court hatte mehrfach Gelegenheit, auf Antrag der Biden-Regierung über die Zulässigkeit landesweiter einstweiliger Verfügungen zu entscheiden – und lehnte jedes Mal ab. Doch kaum ist eine Regierung im Amt, die das Recht offen und systematisch missachtet, nutzen die republikanischen Richter*innen die Gelegenheit: Ausgerechnet in den ersten sechs Monaten dieser Präsidentschaft schränken sie die Befugnisse der unteren Gerichte ein – und das ausgerechnet in einem der Fälle, in dem das rechtswidrige Handeln der Regierung am offensichtlichsten ist. Im Falle der Executive Order zu birthright citizenship ist das eindeutig. Dass der Supreme Court sich dazu entschied, ausgerechnet in diesem Fall einzugreifen – und dabei die Autorität der unteren Instanzen zu schwächen –, verleiht den Rechtsbrüchen der Regierung erneut den Anstrich der Rechtmäßigkeit. Mehrere Regierungsvertreter*innen feiern das Urteil, denn es stützt – wenn auch indirekt – die Regierungsangriffe auf Gerichte, die es wagen, sich ihr entgegenzustellen. Mit dieser Entscheidung, zu diesem spezifischen Zeitpunkt, sendet das Gericht ein unmissverständliches Signal: Die Regierung beschwert sich zu Recht gegen gerichtliche Kontrolle – und sie sollte weiter Druck machen.
Die Richterinnen Sotomayor und Jackson formulieren diese Sorgen in ihren abweichenden Meinungen. Sotomayor warf dem Gericht vor, sich „beschämenderweise“ auf das „Taktieren“ der Regierung eingelassen zu haben – nämlich in einem Fall, in dem die Regierung in der Sache kaum etwas zu ihrer Verteidigung vorzutragen hatte, weil ihre Politik eindeutig rechtswidrig ist. „Weil ich mich an einem so gravierenden Angriff auf unser System nicht mitschuldig machen will“, schrieb sie für die drei demokratischen Richterinnen, „widerspreche ich.“ Noch schärfer formulierte es Richterin Jackson, als sie die Rolle des Gerichts im Umgang mit den unteren Instanzen kritisiert: „Dass dieses Gericht an der Herausbildung einer Kultur der Verachtung von unteren Gerichten, deren Urteilen und Rechtsauslegung mitwirkt, wird den Zerfall unserer staatlichen Ordnung mit Sicherheit vorantreiben.“
Manche der Supreme-Court-Entscheidungen mögen – für sich genommen und abstrakt betrachtet – noch irgendwie rechtlich zu begründen sein. Doch zusammengenommen und vor dem konkreten politischen Hintergrund bedeuten sie nichts weniger als die Legitimierung einer Exekutive, die ein Grundprinzip des Rechtsstaats ablehnt: dass Präsident und Regierung dem Gesetz unterliegen. Das Muster ist dabei stets dasselbe: Die republikanischen Richter*innen verpassen den bad vibes der republikanischen Partei und ihres Präsidenten – in diesem Fall: schlichte Gesetzlosigkeit – einen rechtmäßigen Anstrich. Soweit man das, was die republikanischen Richter*innen tun, überhaupt noch Recht nennen kann – dann ist es wohl ein Recht der Gesetzlosigkeit; ein Recht, das geradezu dazu einlädt, diesen rechtswidrigen Weg weiter zu beschreiten.
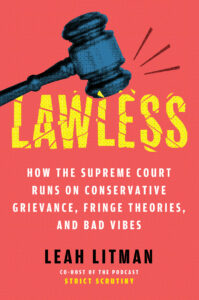 Dieses Editorial ist Teil unseres Spotlights zu „US Democracy Under Threat“, das Beiträge von führenden Wissenschaftler*innen aus Rechts- und Politikwissenschaft versammelt.
Dieses Editorial ist Teil unseres Spotlights zu „US Democracy Under Threat“, das Beiträge von führenden Wissenschaftler*innen aus Rechts- und Politikwissenschaft versammelt.
Leah Litman ist Autorin des New York Times Bestsellers „LAWLESS: How the Supreme Court Runs on Conservative Grievance, Fringe Theories, and Bad Vibes“.
*
Editor’s Pick
von JANA TRAPP
 Man kann keinen Hund zum Editor’s Pick ernennen, auch wenn er sich gerade mit großen Augen darum bewirbt. Aber wenn ich diese Woche etwas teilen möchte, das mir so stille Zuversicht schenkt wie sonst nur mein Hund, dann ist es Mary Olivers Dog Songs.
Man kann keinen Hund zum Editor’s Pick ernennen, auch wenn er sich gerade mit großen Augen darum bewirbt. Aber wenn ich diese Woche etwas teilen möchte, das mir so stille Zuversicht schenkt wie sonst nur mein Hund, dann ist es Mary Olivers Dog Songs.
Oliver ist das Kunststück gelungen, mit ihrem Gedichtband einzufangen, wie es ist, einen vierbeinigen Seelentröster an seiner Seite zu wissen: mit feuchter Nase, wedelndem Schwanz und einem Blick, der alles sagt. „Everybody needs a safe place“, schreibt sie. Ihre Liebeserklärungen sind ein solcher Ort: sicher, warm, ein bisschen zerzaust, voller Liebe und dem bittersüßen Wissen, dass jeder Abschied einmal kommt. Wer liest, spürt das leise Glück, das Hunde in unser Leben tragen, und erinnert sich dabei, wieder auf die kleinen Dinge zu achten. Vielleicht herzen Sie heute Ihren Hund einmal extra fest. Und wenn Sie keinen haben – dieses Buch ist die zweitschönste Möglichkeit, sich kurz und heilsam ans Herz fassen zu lassen.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von CHARLOTTE HERBERT
Die Delegitimierungskampagnen der Trump-Administration (siehe LEAH LITMAN oben) bedrohen nicht nur die Unabhängigkeit der Justiz – auch die Wissenschaftsfreiheit gerät weiterhin unter Druck. So trat der Präsident der University of Virginia zurück, nachdem das Weiße Haus eine politische Kampagne gegen ihn gestartet hatte. J. PETER BRYNE (EN) erklärt, dass die Diversity-, Equity- und Inclusion-Politiken (DEI) der Universität rechtlich völlig unproblematisch gewesen seien. Doch das helfe wenig, wenn institutionelle und öffentliche Unterstützung in einem zunehmend autoritären Umfeld schwinden.
Außenpolitisch setzt Trump im Iran auf Abschreckung. MARY ELLEN O’CONNELL (EN) widerspricht dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der im Vorfeld von Trumps Besuch in Den Haag die US-Angriffe auf den Iran als völkerrechtskonform einstufte. Das sei falsch: sich auf die Abschreckungstheorie zu stützen, untergrabe vielmehr den sichersten Weg zum Frieden.
MICHAEL J. GLENNON (EN) zeigt außerdem, dass der Angriff nicht nur Völkerrecht verletze, sondern auch amerikanischem Verfassungsrecht widerspreche: Er hätte der Zustimmung des Kongresses bedurft.
In der EU stand diese Woche das Asylrecht im Fokus. So liegt etwa Italiens Versuch, Asylverfahren nach Albanien auszulagern, nun in einem Vorabentscheidungsverfahren dem EuGH vor. ANDREINA DE LEO (EN) beleuchtet die rechtlichen Fiktionen und die Zukunft des italienischen Externalisierungsmodells.
Die italienische Asylpolitik kritisiert auch MALAK HARB (EN), die die jüngste Entscheidung des EGMR im Fall S.S. u.a. gegen Italien untersucht: Statt sich mit der funktionalen Gerichtsbarkeit im Kontext externalisierter Migrationskontrolle auseinanderzusetzen, stelle das Gericht lediglich fest, dass Italien keine extraterritoriale Gerichtsbarkeit über eine Gruppe irregulärer Migrant*innen habe, deren Schiff in internationalen Gewässern nahe der libyschen Küste havariert war.
Positiver bewertet MATILDE ROCCA (EN) die Entscheidung der Großen Kammer des EuGH in Kinsa. Sie sieht darin einen wichtigen Schritt, um die Fürsorge für schutzsuchende Kinder zu entkriminalisieren – warnt jedoch, dass ihre Schutzstandards dadurch künftig dennoch geschwächt werden könnten.
In Deutschland beschäftigt uns migrationsrechtlich noch immer die Frage der Zurückweisungen an den Binnengrenzen. Nachdem Innenminister Dobrindt trotz einer Entscheidung des VG Berlin – und wohl rechtswidrig – dort weiterhin Zurückweisungen veranlasst, stellt sich die Frage, ob Bundesbeamt*innen dagegen remonstrieren müssen. ANDREAS NITSCHKE und KLAUS KREBS (DE) verneinen dies: Auch bei berechtigten „Bedenken“ an der Rechtmäßigkeit seien hohe Anforderungen an eine solche Pflicht zu stellen.
Verpflichtet sieht hingegen JOACHIM WIELAND (DE) den deutschen Gesetzgeber, den Schwangerschaftsabbruch neu zu regeln. Diese Pflicht ergebe sich aus Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes: Der Staat habe die Würde von Schwangeren zu achten – und verletze diese Achtungspflicht mit der derzeitigen Regelung.
Auch die Entwicklungen in Rumänien und Ungarn waren diese Woche wieder Thema. Nachdem verpflichtende Vermögenserklärungen in Rumänien zunächst Hunderte korrupte Amtsträger*innen entmachtet hatten, hat das Verfassungsgericht diese Praxis nun gekippt. TILMAN HOPPE (EN) erläutert, warum andere Länder diesen Weg besser nicht einschlagen sollten.
Einen weiteren Kommentar zu den Schlussanträgen der Generalanwältin Ćapeta im EuGH-Fall Kommission gegen Ungarn, in dem es um das ungarische „Anti-LGBTIQ“-Gesetz geht, liefert LEIJLA KRUSEVLJANIN (EN). Sie verteidigt die Argumentation der Generalanwältin und sieht darin einen verfassungsrechtlich schlüssigen und notwendigen Schritt, um die Grundwerte der Union zu schützen.
Positiv fällt auch das Urteil von JANNIS LENNARTZ und VIKTORIA KRAETZIG (EN) zu den Schlussanträgen des Generalanwalts Emiliou in Pelham aus: In diesem Urheberrechtsstreit rücke der Generalanwalt endlich wieder Autor*innen und Künstler*innen in den Mittelpunkt und erinnere daran, dass das Urheberrecht vor allem Kreativität schützen soll – nicht bloß kommerzielle Interessen.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Out now! ✨

Anmol Jain & Tanja Herklotz (eds.)
Indian Constitutionalism at Crossroads: 2014-2024
Narendra Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP) has governed India since 2014, marking a decade of challenges to various aspects of India’s democracy and constitutional system. While the last decade may not have left many conspicuous signs textually, the soul of India’s constitutional system has suffered several dents. The ruling government has launched, quite successfully, a project of redefining India, its constitutional identity, and its vision. This edited volume explores these multifaceted challenges and assesses the current state of Indian Constitutionalism.
Now available as _soft copy _(open access) and in print!
++++++++++++++++++++++++++++
Im Netz sorgte vor einigen Tagen die Ankündigung der Petitionsplattform innn.it (ehemals Change.org) für Aufsehen: Nach jahrelangem Rechtsstreit kündigte die Plattform an, als Reaktion auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs auf ihre Gemeinnützigkeit zu verzichten. Wer ist hier zu weit gegangen – die Plattform oder der Bundesfinanzhof? ANNA LEISNER-EGENSPERGER (DE) hat Antworten.
Apropos zu weit gehen: Wie und wie weit kann Demokratie eigentlich eingeschränkt werden, bevor sie ihre demokratische Natur verliert? Für MAXIMILIAN KRAHÉ und MICHAEL W. MÜLLER (EN) stellt sich die Frage vor allem fiskalpolitisch – und wirft viele weitere wichtige Fragen auf.
Ähnlich wichtige Fragen hat nun u.a. die Pan African Lawyers Union dem Afrikanischen Gerichtshof für Menschen- und Rechte der Völker gestellt: Es geht um völkerrechtliche Pflichten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. NOUWAGNON OLIVIER AFOGO, MARIA ANTONIA TIGRE, ARMANDO ROCHA und MIRIAM COHEN (EN) analysieren den Antrag auf eine Advisory Opinion und erklären, warum dies ein juristischer Wendepunkt für die Region sein könnte.
Diese Woche haben wir unser Symposium zu „Animal Rights: The Role of the EU Charter“ (EN) gestartet, mitherausgegeben von ESTER HERLIN-KARNELL UND MATILDA ARVIDSSON. Im juristischen Diskurs der EU spielen Tiere bislang eine eher untergeordnete Rolle, insbesondere in der Grundrechtecharta. Das Symposium geht der Frage nach, ob die Charta Impulse für einen stärkeren Tierschutz in den Mitgliedstaaten setzen kann. ESTER HERLIN-KARNELL and MATILDA ARVIDSSON gehen zum Einstieg der Frage nach, inwiefern die Charta auch nicht-menschliches Leben schützen kann – und rufen dazu auf, die anthropozentrische Ausrichtung des Rechts grundsätzlich zu hinterfragen. HANS LINDAHL gibt zu bedenken, dass es wenig nützt, Tierrechte in der Charta zu verankern, solange das Privatrecht weiterhin Leben zur Ware macht. POUL F. KJAER meint, dass das Schweigen der Charta über Tiere weniger über Tiere selbst aussagt, als über unser Verständnis der „sozialen Voraussetzungen“ europäischer Werte. MANEESHA DECKHA fragt, ob ein Recht auf Bildung nicht auch bedeuten könnte, Kindern Wissen über Tierleid und Tierschutz zu vermitteln – als Teil ihrer Grundrechte. BERTJAN WOLTHUIS kritisiert die Entscheidung der EU, nach vermehrten Angriffen auf Nutztiere den Schutzstatus von Wölfen zu lockern: Wölfe bräuchten Raum, nicht Strafe – und die EU sollte das Schutzgebietssystem Natura 2000 konsequent ausbauen. ESTER HERLIN-KARNELL zeigt auf, dass die EU bereits über alle nötigen Instrumente verfügt, um Tierrechte ernst zu nehmen, und lotet deren Möglichkeiten aus. YAFFA EPSTEIN and EVA BERNET KEMPERS setzen sich für eine post-anthropozentrische Neuausrichtung des EU-Tierschutz- und Umweltrechts ein, in der auch nicht-menschliche Wesen als potenzielle Träger*innen von Rechten anerkannt werden.
Auch wenn für viele die Rechte von nicht-menschlichen Wesen angesichts der derzeitigen Krisen nicht an erster Stelle stehen mögen: dass es auch im Umgang mit dem Recht Kreativität braucht, um aus den Krisen heraus zu finden, ist ein wichtiger Impuls des Symposiums.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.





