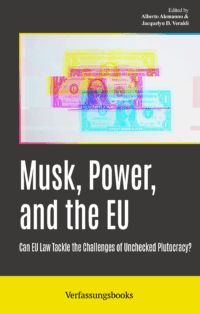Die Qualen des amerikanischen Föderalismus
Eine historische Perspektive auf den Konflikt in Los Angeles
In der Nacht zum Samstag, dem 7. Juni, ordnete Präsident Trump den Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles an, „um ICE und andere Mitarbeiter der Bundesregierung, die Funktionen auf Bundesebene wahrnehmen, vorübergehend zu schützen.“ Die Anordnung sieht den Einsatz von 2.000 Soldaten der Nationalgarde für mindestens 60 Tage vor und ermächtigt den Verteidigungsminister, „nach Bedarf“ reguläre Bundestruppen zur Verstärkung heranzuziehen. Tatsächlich sind bereits Marines im Einsatz. Bemerkenswert ist, dass das Präsidialmemorandum die Proteste – eigentlich ein Paradebeispiel für die durch das First Amendment garantierte Meinungsfreiheit – als „eine Form des Aufstands gegen die Autorität der Vereinigten Staaten“ einstuft.
In den sozialen Medien sprach der Präsident von einer „Invasion und Besetzung“ durch „gewalttätige, aufständische Banden“ und forderte seine Vertrauten auf, „Los Angeles von der Migranteninvasion zu befreien“. Sein Berater Stephen Miller redete gar von einem „Kampf um die Rettung der Zivilisation“. Diese Schmittsche Rhetorik lässt eine langwierige und potenziell gewaltsame Auseinandersetzung erwarten. Zugleich ignoriert die Regierung wiederholt föderale Gesetze und Verfassungsrecht: Wenn sich eine Regierung nicht einmal in ruhigen Zeiten nicht an geltendes Recht gebunden sieht, droht in Krisenlagen erst recht destabilisierender Machtmissbrauch – mit unabsehbaren Folgen.
Wie sich die Lage in Los Angeles entwickelt, hängt weniger von der vergleichsweise engen Rechtsgrundlage ab, auf die sich Trumps Anordnung stützt – ursprünglich vorgesehen zum Schutz von Bundespersonal und -anlagen – , als vielmehr von der Eskalations- oder (weniger wahrscheinlichen) Deeskalationsdynamik vor Ort. Historische oder juristische Präzedenzfälle, die als Orientierung dienen könnten, gibt es kaum. Zwar griff Präsident Lyndon Johnson im März 1965 ebenfalls in Protestgeschehen ein – doch war die Konstellation damals eine gänzlich andere: Erstens wollte Johnson die Grundrechte der Demonstrant*innen gegen staatliche Gewalt schützen. Zweitens blieb sein Vorgehen frei von hetzerischer Rhetorik à la Trump und Miller, die heute den Konflikt anheizt und blutige Konfrontationen wahrscheinlicher macht. Am ehesten vergleichbar erscheint noch der Einsatz von Bundeskräften gegen BLM-Proteste in Portland während Trumps erster Amtszeit; doch als Vorbild kann auch dieser kaum dienen.
++++++++++Anzeige++++++++++++

Die Abteilung Öffentliches Recht des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg im Breisgau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Postdocs (w/m/d); die Möglichkeit zur Habilitation ist gegeben.
Wenn Sie zur Spitzenforschung in den Bereichen Sicherheitsrecht, Öffentliches Rechts sowie Rechtsphilosophie und -theorie beitragen möchten, laden wir Sie herzlich ein sich zu bewerben.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie hier.
++++++++++++++++++++++++++++
Die Ereignisse in Los Angeles treffen einen Grundpfeiler der US-Verfassung: den Föderalismus. In der amerikanischen Verfassungstradition galt die Machtverteilung auf subnationale Einheiten stets als Bollwerk demokratischer Freiheit. Sie gehört zu den „divide and limit“-Strategien, mit denen James Madison und andere Verfassungsväter antidemokratische Machtkonzentration verhindern wollten. Doch der entschlossene Widerstand des kalifornischen Gouverneurs – ganz abgesehen von der unklaren räumlichen Reichweite der Präsidialanordnung – stellt diese Schutzfunktion grundlegend in Frage.
Was unter „Föderalismus“ zu verstehen ist, hat sich in der amerikanischen Verfassungsgeschichte seit 1797 mehrfach gewandelt. Vereinfacht lassen sich drei Modelle unterscheiden, doch alle drei scheinen heute überholt.
In den Jahrzehnten nach der Gründung dominierte zunächst das Bild von Bund und Einzelstaaten als „getrennten Souveränen“, ein System sogenannter „dualer Souveränität“. Ganz falsch ist das zwar nicht, aber auch nur die halbe Wahrheit: Meine Kollegin Alison LaCroix zeichnet ein weitaus differenzierteres Bild. Jedenfalls ab den 1930er-Jahren war klar, dass dieses dualistische Modell nicht mehr funktionierte – es kollabierte unter dem regulatorischen Sozialstaat des New Deal und den Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs.
In den Trümmern dieses Konzepts entwickelte sich der sogenannte Prozessföderalismus – einer Theorie, die nicht auf getrennte Zuständigkeiten setzte, sondern auf politische und institutionelle Schutzmechanismen innerhalb des repräsentativen Systems. Herbert Wechsler etwa betonte die „entscheidende Rolle“, die den Bundesstaaten bei der Auswahl und Zusammensetzung der nationalen Autorität zukomme – etwa durch Senatswahlen, die Wahlkreisaufteilung im Repräsentantenhaus und das Electoral College. All diese Mechanismen sollten, so Wechsler, Bundespolitiker*innen davon abhalten, nicht „in die Domänen der Einzelstaaten“ einzugreifen. Eine spätere Spielart dieser Theorie entwickelte Larry Kramer, für den die nationalen Parteien als eine Art Vehikel dienten, um lokale Interessen der Staaten an die Bundesebene weiterzuleiten. Obwohl Wechslers Ansatz durchaus Einfluss auf den Supreme Court hatte, stießen beide Ansätze auf Kritik, nämlich dass sie mit der tatsächlichen Funktionsweise politischer Institutionen wenig zu tun hätten. Die zunehmende Nationalisierung der Parteien hätte den föderalen Vermittlungsmechanismus längst ausgehöhlt.
Seit den 2010er Jahren hat sich schließlich ein drittes Föderalismusmodell herausgebildet, das von einer anderen Beobachtung ausgeht: Bund und Einzelstaaten kooperieren zunehmend bei der Bereitstellung zentraler öffentliche Güter – von Infrastruktur über Lebensmittel- und Arzneimittelregulierung bis hin zu Mutter-Kind-Schutzprogrammen. Innerhalb dieser überwiegend bundesgesetzlichen Programme wirken die Einzelstaaten als „Komponenten des nationalen Verwaltungsapparats“. So hat meine Kollegin Bridget Fahey gezeigt, wie das Verwaltungsrecht in diesem kooperativen Föderalismus jene Strukturen vorgibt, über die Staaten ihre politischen Präferenzen – und ihren Widerstand – einbringen können. Treffend fasst sie diesen Ansatz unter dem Begriff „Föderalismus […] durch Integration“ zusammen.
++++++++++Anzeige++++++++++++

Juniorprofessur W1 Tenure-Track W3 (m/w/d) für Öffentliches Recht und Energierecht zu besetzen.
Verbunden mit der Stelle ist ein Engagement in der Leitung des Instituts für Berg- und Energierecht an der Juristischen Fakultät. Unter dem RUB-Leitbild „Creating Knowledge Networks“ (Profilschwerpunkt Energiesystemtransformation und Ressourcenmanagement) wird eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, der Fakultät für Maschinenbau und dem Research Department Closed Carbon Cycle Economy der RUB erwartet.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Stellenausschreibung.
++++++++++++++++++++++++++++
Die zweite Trump-Administration vollzieht nun eine radikale Abkehr von allen drei Modellen – zugunsten eines autoritären Zentralismus, der auf Zwang, Unterwerfung und notfalls Gewalt setzt. Los Angeles ist nur das sichtbarste Beispiel dafür, aber bei weitem nicht das einzige.
Gleichzeitig zieht sich die Regierung gezielt aus Bereichen zurück, in denen sie bislang essenzielle öffentliche Güter bereitgestellt hat – Leistungen, auf die die Einzelstaaten in vielerlei Hinsicht angewiesen sind. Ende Mai etwa kündigte sie einen Vertrag zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen Grippeviren mit Pandemiepotenzial, darunter auch die H5N1-Vogelgruppe. Nur Wochen später kündigte das Weiße Haus an, das Chemical Safety Board schließen zu wollen – eine kleine, aber wichtige Behörde zur Überwachung industrieller Risiken. Dies sind nur zwei Beispiele von vielen; eine vollständige Liste würde Seiten füllen.
Zugleich nutzt die Bundesregierung die enge Einbindung der Bundesstaaten in kooperative föderale Programme – ebenso wie deren strukturelle Abhängigkeit von finanzieller Unterstützung oder zumindest funktionaler Kooperation mit Washington – zunehmend als politisches Druckmittel. So drohte sie etwa, sämtliche Bundesmittel für die University of California und das Cal-State-System zu streichen, sollte bestimmten kulturpolitischen Vorgaben nicht Folge geleistet werden. Ähnliche Drohungen trafen Maine, Kalifornien und Städte mit sogenannten „Sanctuary“-Regelungen – also Vorschriften, die eine Zusammenarbeit mit den Einwanderungsbehörden des Bundes bewusst einschränken. Begleitet wurde dies von Ankündigungen, als feindlich angesehene Amtsträger*innen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verklagen.
All dies zeichnet das Bild eines tiefgreifenden, gravierenden und politisch aufgeladenen Strukturwandels der amerikanischen Bundesbeziehungen. Die Bundesregierung sieht sich nicht mehr an Gesetz und Recht gebunden, sondern behandelt (ideologisch abweichende) Bundesstaaten und Städte mit offener Missachtung, ökonomischem Druck und, wenn nötig, mit militärischer Härte. Sie droht, sie nötigt – doch sie verhandelt nicht. Inzwischen lässt sich wohl sagen: Was hier entsteht, erinnert mehr an Feudalismus als an Föderalismus.
Am Anfang meines Textes stand die Frage, wie sich die Lage in Los Angeles entwickeln wird. Doch hinter diesem konkreten Konflikt steht längst eine grundlegendere. Föderalismus setzt ein Mindestmaß an Autonomie der Bundesstaaten voraus. Die Regierung lehnt aber genau dieses Prinzip ab. Die eigentliche Frage lautet also: Kann der amerikanische Föderalismus – in welcher Form auch immer – unter diesen Bedingungen überleben?
*
Editor’s Pick
von CHARLOTTE HERBERT

(Bild generiert durch KI)
Ich bin natürlich nicht die Erste, der auffällt, dass viele einst noch dystopische Erzählungen heute nicht mehr bloß wie düstere Zukunftsvisionen wirken. 1984 liest sich inzwischen fast wie ein Alltagsszenario; die Prämisse von The Last of Us kann kaum noch schockieren und so manche Black Mirror-Folge wird unseren Nachfahren einmal als Dokumentation technischer Neuerungen dienen. Doch selten hat mich diese Entwicklung so bedrückt wie beim Ansehen der neuen und letzten Staffel von The Handmaid’s Tale, die längst nicht mehr so dystopisch wirkt wie einst Atwoods Romanvorlage von 1985. Darin weichen die USA dem autoritären Staat Gilead, in dem Frauen primär dem Gebären dienen und politische Gegner gewaltsam unterdrückt werden. Die letzte Staffel beendet den Kampf der Protagonistin June gegen das Regime, das ihre Tochter entführt hat. June ist stark, laut und vor allem wütend. Trump würde ihr wohl einen Kurs zur Wutbewältigung empfehlen – die letzten Tage und Monate haben aber doch vor allem eins gezeigt: Auch unsere dystopische Welt braucht mehr „young angry women.“
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von CHARLOTTE HERBERT
Trumps neuste Eskalation: Er lässt in Los Angeles in die Nationalgarde einsetzen, um teils friedliche Proteste gegen seine aggressive Einwanderungspolitik zu zerschlagen. Das gefährdet nicht nur den Föderalismus (s. oben), sondern wirft auch sonst schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken auf, wie EMILY BERMAN (EN) feststellt.
Dass die Trump-Administration sukzessive politische und institutionelle Strukturen umbaut, zeigt auch SUSAN ROSE-ACKERMAN (EN): Trump bereichere sich nicht nur selbst, sondern schwäche gezielt Kontrollmechanismen gegen Korruption, um seiner persönlichen Idealvorstellung einer Kleptokratie näherzukommen.
Trump treibt außerdem seine internationale Abschottung voran: Die jüngsten US-Sanktionen gegen vier IStGH-Richter*innen seien jedoch nichts Neues, beobachtet JEAN GALBRAITH (EN), sondern ständen in einer langen US-Tradition der Ablehnung internationaler Gerichtsbarkeit.
Der Abschottung dienen auch die US-Einreisebeschränkungen. Die Entscheidung des US Supreme Court zum „Muslim Ban“ lässt viele daran zweifeln, dass eine Diskriminierungsklage gegen solche Einreiseverbote Erfolg haben könnte. ILYA SOMIN (EN) hält die verfassungsrechtlichen Einwände gegen Trumps Vorgehen dennoch für stichhaltig – und für zu bedeutend, um sie ungehört zu lassen.
Dass neue Bedrohungen innovatives juristisches Handeln erfordern, beweisen auch ARMIN VON BOGDANDY und LUKE DIMITRIOS SPIEKER (EN): Ungarn droht, die Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland zu blockieren – dem könne jedoch durch eine gezielte, rechtlich begründete Neutralisierung des ungarischen Vetos begegnet werden.
++++++++++Anzeige++++++++++++

Neue Ausschreibung des Ph.D. Stipendienprogramms „Uncertainty“
Das interdisziplinäre, internationale Stipendienprogramm „Uncertainty“ der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS fördert Promotionsvorhaben aus den Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften zum Thema “Ungewissheit”. Das Programm umfasst Stipendien für verschiedene Promotionsphasen: Start Up Scholarships (sechs Monate), Ph.D Scholarships (ein bis drei Jahre) und Dissertation Completion Scholarships (ein Jahr). Darüber hinaus fördert die Stiftung den interdisziplinären Austausch und die Vernetzung durch Workshops und jährliche Konferenzen.
Weitere Informationen zum Stipendienprogramm und Bewerbungsprozess finden Sie hier.
++++++++++++++++++++++++++++
Aus der EU haben uns diese Woche vor allem die Schlussanträge von Generalanwältin Ćapeta im Fall Commission v. Hungary beschäftigt, in dem es um das ungarische „Anti-LGBTIQ“-Gesetz geht. KONSTANTINOS LAMPRINOUDIS (EN) legt dar, wie die Kommission angesichts des begrenzten LGBTIQ-Schutzes im EU-Antidiskriminierungsrecht versucht, den Schutz dieser Minderheiten durch die Kombination verschiedener Rechtsgrundlagen zu gewährleisten.
LENA KAISER (EN) analysiert die beispiellosen Ausführungen von Ćapeta zur Justiziabilität und der Verletzung von Artikel 2 EUV in dieser anstehenden Grundsatzentscheidung. Sie begrüßt das Ergebnis, kritisiert aber die vage Argumentation.
Auch die Präsidentschaftswahl in Polen war diese Woche noch bei uns Thema. WOJCIECH ZOMERSKI (EN) macht vor allem den Glaubwürdigkeitsverlust der polnischen Liberalen für den überraschenden Sieg von Nawrocki verantwortlich: Der liberale Kandidat Trzaskowski habe versucht, konservative Wähler zu gewinnen, indem er sich von progressiven Positionen distanzierte – für Progressive ein Verrat, für Konservative unauthentisch.
PAULINA MILEWSKA (EN) befürchtet, dass Polen jetzt Teil einer wachsenden transatlantischen Achse des Rechtspopulismus wird und damit Russlands Strategie in die Hände spielt, Europa weiter zu spalten.
Dem Rechtspopulismus könnte kürzlich etwas in die Hände gespielt haben: nämlich die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch. MICHAEL MEYER-RESENDE (DE) hält die Einstufung zwar im Ergebnis für richtig, kritisiert aber die Beweisführung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Bericht dramatisiere unproblematische Aussagen und banalisiere dadurch die zahlreichen extremistischen – was der AfD zugutekomme.
Welche Waffen das Recht gegen den Waffenbesitz von AfD-Mitgliedern hat, beschäftigte unterdessen das OVG Münster. Das Gericht hat den Widerruf einer waffenrechtlichen Erlaubnis gegenüber einem AfD-Mitglied nun für rechtswidrig erklärt. MARC ANDRÉ WIEGAND (DE) hält das für dogmatisch richtig, dennoch müsse der Gesetzgeber die Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Waffenbesitzer*innen verschärfen.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Musk, Power, and the EU: Can EU Law Tackle the Challenges of Unchecked Plutocracy?
(Edited by Alberto Alemanno & Jacquelyn D. Veraldi)
As calls for an EU response to Musk’s actions grow, the question of whether, why, and how the EU reacts remains open. Is Musk’s conduct problematic in terms of disinformation, electoral integrity, abuse of power, or a combination of these factors? This edited volume unpacks whether and how (EU) law may tackle the existence and exercise of unprecedented plutocratic power. The authors explore a multitude of legal avenues, from freedom of speech to competition law, technology law, data protection to corporate taxation.
Now available as soft copy (open access) and in print!
++++++++++++++++++++++++++++
Eine zuverlässigere Beweisführung erhoffen sich die Strafverfolgungsbehörden vom sog. „genetischen Phantombild“ durch erweiterte DNA-Analyse. ALINA GARSTEIN und RABEA BRENNER (DE) zeigen jedoch, warum die Technik mehr Unsicherheiten schafft als beseitigt und welche erheblichen Risiken für Diskriminierung und Fehldeutungen sie birgt.
Um Diskriminierung ging es (eigentlich) auch in einer jetzt veröffentlichten Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofs: Muss der Senat parlamentarische Anfragen nach Vornamen deutscher Tatverdächtiger beantworten? Obwohl solche Anfragen offensichtlich rassistisch motiviert sind, erwähnt die Mehrheitsentscheidung Rassismus mit keinem Wort. TARIK TABBARA und JELENA VON ACHENBACH (DE) besprechen den Beschluss und schließen sich dem Minderheitenvotum an: Das verfassungsrechtliche Antidiskriminierungsrecht verpflichte dazu, die Beantwortung einer solchen Frage zu verweigern.
MICHAEL NEUPERT (DE) sieht auch am OLG Hamm eine gerichtlich verpasste Chance: Statt aus der spektakulären Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen RWE eine juristische Großerzählung über globale Verantwortung und Eigentum zu machen, erschöpft sich das Gericht in 139 Seiten Beweiswürdigung – als ginge es um einen Nachbarschaftsstreit in Wanne-Eickel.
Und schließlich haben wir diese Woche unser Symposium zu „GEAS-Reform: Halbzeit bis zur Anwendung“ (DE) fortgesetzt. „Haft“ und Freiheitsbeschränkungen sind bei der Reform zentrale Schlagworte. ROBERT NESTLER zeigt, inwiefern Möglichkeiten formeller Inhaftnahme zunehmen und wo faktische Inhaftierungspotentiale liegen. DILKEN ÇELEBI, REBEKKA BRAUN und CATHARINA CONRAD warnen, dass die durchaus vorhandenen Fortschritte in Bezug auf vulnerable Gruppen bei der Umsetzung unter die Räder geraten könnten. KATHARINA STÜBINGER gibt einen Überblick über die Neuerungen beim Rechtsschutz und weist darauf hin, dass dessen Wirksamkeit angesichts von Art. 47 der EU-Grundrechtecharta nicht verhandelbar sei. Nächste Woche erscheinen vier weitere Debattenbeiträge.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.