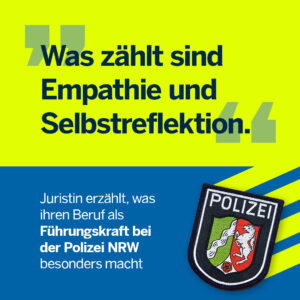Expressive Empörung
Hat der US Supreme Court genug von Donald Trump?
Verliert der US Supreme Court die Geduld mit Donald Trump? Das Urteil A.A.R.P. v. Trump vom 19. April 2025 könnte einen Wendepunkt in der Beziehung zwischen dem Gericht und der Trump-Administration markieren – insbesondere mit Blick auf die Migrationspolitik. Mit sieben zu zwei Stimmen erließ das Gericht eine einstweilige Verfügung, die es der Regierung untersagt, angeblich irreguläre Migrant*innen nach dem Alien Enemies Act von 1798 aus den USA abzuschieben.
Auf das Bemerkenswerte an diesem Vorgang wies auch Richter Samuel Alito in seinem Sondervotum hin: Der Supreme Court erließ die Verfügung, obwohl die Regierung dem unterinstanzlichen Gericht mitgeteilt hatte, dass die Antragsteller*innen in den nächsten Tagen ohnehin nicht abgeschoben würden. Auch wenn die einstweilige Verfügung keine Begründung enthält, aus Sicht vieler Beobachter*innen ist klar, dass die richterliche Mehrheit damit nicht länger bereit ist, Zusicherungen der Trump-Regierung zu glauben. Die Regierung habe in den jüngsten migrationsrechtlichen Verfahren zu erkennen gegeben, dass sie sich der rule of law nicht verpflichtet fühlt.
Nur wenige Tage zuvor hatte der Supreme Court noch einen ganz anderen Ton angeschlagen. In Trump v. J.G.G. (7. April 2025) hob eine knappe 5-zu-4-Mehrheit eine einstweilige Verfügung auf, die der Trump-Administration untersagte, venezolanische Staatsangehörige – laut Justizministerium mutmaßliche Bandenmitglieder – auf Grundlage des Alien Enemies Act abzuschieben. Die Mehrheit der Richter*innen erblickte das Problem darin, dass sich die Kläger*innen fälschlicherweise auf den Administrative Procedure Act berufen hätten, obwohl ein habeas corpus-Verfahren richtig gewesen wäre. Nichts an dieser per curiam-Entscheidung – einer kurzen, nicht namentlich unterzeichneten Stellungnahme des gesamten Gerichts – ließ Zweifel daran erkennen, dass an diesem Fall etwas nicht stimmen könnte. Stattdessen bestätigte die richterliche Mehrheit nüchtern: „Die Inhaftierten… haben Anspruch auf eine Benachrichtigung und die Möglichkeit, ihre Abschiebung anzufechten. Die einzige Frage ist, welches Gericht dafür zuständig ist.“ Das Gericht entschied den Fall also letztlich anhand einer juristischen Formalfrage – ganz so, als würde es sich um einen Fall wie jeden anderen auch handeln. Ein paar Fachleute für Verfahrensrecht ringen nun zwar mit der Frage, ob die Anwält*innen der Inhaftierten tatsächlich auch wirklich jede Formalität beachtet haben. Wer allerdings nicht gerade hauptberuflich zum Thema Bundesgerichtsbarkeit unterrichtet, wird kaum einschätzen können, ob das Gericht in einem politisch weniger brisanten Verfahren ähnlich entschieden hätte. Eine wiederauferstandene Hannah Arendt hätte hierin möglicherweise einen Anlass gefunden, ihrer „Banalität des Bösen“ ein Nachwort hinzuzufügen.
In Noem v. Abrego Garcia (10. April 2025) gab sich das Gericht im Ton erneut sachlich, kam jedoch zu einem anderen Ergebnis. Die Richter*innen wiesen die Trump-Administration an, „die Freilassung von Abrego Garcia aus der Haft in El Salvador zu ermöglichen und sicherzustellen, dass sein Fall so behandelt wird, als wäre er nicht unrechtmäßig abgeschoben worden.“ Auch diesmal vermittelten die Richter*innen den Eindruck, dass in der Praxis der Trump-Administration grundsätzlich alles mit rechten Dingen zugehe – es handele sich nur um einen Einzelfall, der korrigiert werden müsse. Besorgt zeigte sich die Mehrheit vielmehr wegen der untergeordneten Gerichte, denen es an Respekt gegenüber der Exekutive fehle. Man müsse, so der Supreme Court, bei allen Maßnahmen zur Rückführung Garcias die „gebotene Achtung vor der außenpolitischen Rolle der Exekutive“ wahren.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Als Führungskraft Gerechtigkeit aktiv gestalten bei der Polizei NRW. Komm ins TEAM 110!
++++++++++++++++++++++++++++
Was der Mehrheitsmeinung an Empörung fehlte, wog Richterin Sonia Sotomayor – zusammen mit Elena Kagan und Ketanji Brown Jackson – in ihrer abweichenden Meinung auf. Sie stellte fest, dass die Trump-Administration Abrego Garcia in ein „Terrorhaftzentrum“ in El Salvador überstellt hatte, ohne eine „rechtliche Grundlage für dessen grundlose Festnahme, Abschiebung und Inhaftierung“ zu nennen. „Statt diesen eklatanten Fehler“ zu korrigieren, wolle die Trump-Regierung „Abrego Garcia, Ehemann und Vater ohne Vorstrafen, in einem salvadorianischen Gefängnis zurücklassen, ohne rechtlich anerkannten Grund.“ Dies sei ein offener Bruch mit den verfassungsrechtlichen Prinzipien des Rechtsstaats. Sotomayor wies darauf hin, dass laut Vertreter*innen des Justizministeriums Trump „jede Person – auch US-Bürger*innen – ohne rechtliche Konsequenzen abschieben und inhaftieren darf, solange dies vor einer gerichtlichen Prüfung geschieht.“
Richter*innen der unteren Instanzen schlagen dagegen regelmäßig Sotomayors Ton an. Empört bestehen sie darauf, dass Menschen in den USA ein Recht auf ein faires Verfahren zusteht und dass die USA verfassungsrechtlich zur Rückführung verpflichtet sind, wenn die Abgeschobenen nicht zu ihrem Bleiberecht angehört worden sind.
Der von Ronald Reagan ernannte Richter Harvie Wilkinson kritisierte die Trump-Administration scharf für den Versuch, „Einwohner*innen dieses Landes in ausländischen Gefängnissen zu verstecken ohne auch nur die Spur eines rechtsstaatlichen Verfahrens, das doch die Grundlage unserer Verfassungsordnung ist.“ Der von Biden ernannte Richter Brian Murphy formulierte noch deutlicher: „Kongress, gesunder Menschenverstand, minimaler menschlicher Anstand und auch dieses Gericht widersprechen allesamt der Behauptung der Trump-Regierung, die Vereinigten Staaten dürften abschiebepflichtige Personen in Länder verbringen, aus denen sie nicht stammen, die kein Gericht bestimmt hat und in denen ihnen unmittelbar Folter oder der Tod droht – ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, vor der Abschiebung auf diese Gefahr hinzuweisen.“
Auch rechtlich macht Empörung einen Unterschied. Gegenüber Regierungen, die in gutem Glauben handeln und die Verfassung achten, sollten sich Gerichte zurückhalten. Oft verfügen Regierungen über mehr Informationen und demokratische Legitimation als Gerichte, deren Wissen sich häufig auf das beschränkt, was ihnen von Anwält*innen präsentiert wird. Doch stellen Richter*innen fest, dass die Regierung gezielt rechtsstaatliche Prinzipien unterwandert, ist Zurückhaltung nicht mehr angebracht. Die Rassentrennung im Süden der USA konnte erst überwunden werden, als die Justiz nicht mehr auf das staatliche Narrativ reinfiel, demzufolge Jim Crow im Interesse aller sei – und stattdessen anerkannte, dass „Segregation im Bildungswesen in keinem vernünftigen Verhältnis zu einem legitimen staatlichen Ziel“ steht. So formulierte es der Oberste Richter Warren öffentlich (hinter verschlossenen Türen gab er allerdings zu, dass die Rassentrennung in Wahrheit ausschließlich dem Erhalt weißer Vorherrschaft diente). Die Trump-Administration hat durch monatelanges Täuschen, Blockieren und Ignorieren gerichtlicher Anordnungen jeglichen Anspruch auf richterliche Zurückhaltung verspielt. Die Supreme-Court-Richter*innen taten gut daran, dem Justizministerium schweigend mitzuteilen: „Wir glauben euch nicht.“
++++++++++Anzeige++++++++++++
The Max Planck Institute for Social Law and Social Policy is looking for one PhD student and one Postdoc for its research group “Our Children’s Children: A Comparative Analysis of Constitutional Protections of Future Generations”. The group will explore the role of constitutional and public law in safeguarding the rights and well-being of future generations, with a particular focus on climate change, social law and public finances. You can find more information about the positions here and here.
++++++++++++++++++++++++++++
Empörung ist auch wichtiger als Formalitäten. Justice Alito formulierte in seiner abweichenden Meinung zu A.A.R.P. zahlreiche obskure Einwände. Professor Steven Vladeck, renommierter Verfassungsrechtler an der Georgetown Law School, zeigt, dass Alito in allen Punkten falsch liegt. In Alitos Augen, so kann man nur mutmaßen, liegen der Rest der Welt und die Mehrheit der Richter*innen schlicht falsch. In gewöhnlichen Fällen halten sich Richter*innen an die Formalitäten. Empörte Richter*innen schaffen dagegen Gerechtigkeit – sie verstecken sich nicht hinter juristischen Feinheiten, um handfeste Gefahren für die rule of law und die Verfassungsstaatlichkeit durchgehen zu lassen.
Empörung hat aber auch eine expressive Funktion. In den meisten Fällen ist ein nüchterner juristischer Ton angemessen. In ihm zeigt sich, dass verfassungsrechtliche Fragestellungen oft komplex sind und die Parteien in gutem Glauben über die Verfassungsmäßigkeit bestimmter Maßnahmen streiten. Doch wenn eine Regierung systematisch versucht, rechtsstaatliche Prinzipien zu unterwandern, ist ein anderer Ton angebracht. Alle wissen: Die Regierung hat keine Beweise dafür, dass viele der abgeschobenen Personen Bandenmitglieder sind; es gibt keine „Staatsgeheimnisse“, die geheim gehalten werden müssten, und die Regierung El Salvadors ist kaum in der Lage, sich einer ernsthaften Aufforderung der Trump-Administration zu widersetzen, verfassungswidrig abgeschobene Personen in unmenschliche Gefängnisse dieses Landes zurückzuschicken. Wo die Regierung systematisch gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstößt, muss ein Urteil deutlich machen, dass die Richter*innen wissen – und wissen müssen –, dass die Regierung lügt, die Verfassung missachtet und das Recht missbraucht, um politisches Unrecht zu kaschieren.
In A.A.R.P. entschied sich die richterliche Mehrheit für ein stilles Signal: Das Vertrauen in Trumps Justizministerium ist aufgebraucht. Seine Aussagen zur Einwanderungspolitik verdienen keine gerichtliche Beachtung mehr. Denn die häufigen Lügen, taktischen Ausweichmanöver und zahllosen missachteten Gerichtsanordnungen haben gezeigt: Das ist nicht bloß verfassungsrechtlich missglückte Politik, sondern ein gezielter Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung. Früher oder später wird es mehr brauchen als stille Empörung – denn Regierungsbeamte versuchen weiterhin, all jene Personen oder Institutionen verfassungsrechtlich schutzlos zu stellen, die ihren politischen Zielen im Weg stehen. Bleibt die Frage: Kündigt das Urteil an, dass sich der Ton gegenüber der Trump-Regierung ändert – oder bleibt es bei einer leisen, folgenlosen Verstimmung?
*
Editor’s Pick
von MAXIM BÖNNEMANN
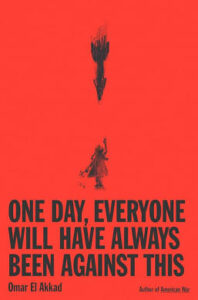
„Es ist vielmehr die Mitte, die liberale, gutmeinende, empfindliche Mitte, die verzweifelt den Schutz dieser Art von Sprache braucht. Denn es ist die Mitte des Empires, die darauf blicken muss und sagt: Ja, das ist tragisch, aber notwendig, denn die Alternative ist Barbarei.“
Der amerikanische Journalist und Autor Omar El-Akkad reflektiert über das Grauen in Gaza und die tiefe Verstrickung der „höflichen liberalen Kreise im Westen“. Angesiedelt zwischen autobiografischen Reflexionen und ebenso scharfen wie verzweifelten Beobachtungen der Gegenwart, schreibt El-Akkad über Schweigen und Verdrängen, über Sprache und Sprachlosigkeit, über den Autoritarismus arabischer Regime und die dunkle, tödliche Seite des westlichen Liberalismus. Eines Tages werden alle immer dagegen gewesen sein – aber bis dahin ist es zu spät.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
Papst Franziskus ist am Ostermontag verstorben. Egal wie Sie zur katholischen Kirche stehen – Papst Franziskus hat Mitgefühl bewiesen. Mitgefühl, das uns in internationalen Rechtsdebatten häufig fehlt. So sagte er bei einer Freiluftmesse in Lampedusa: „Wir sind eine Gesellschaft, die verlernt hat, zu weinen.“ Im Jahr 2024 bezeichnete er die „systematische Arbeit“ von Regierungen, Migrant*innen abzuschrecken, als „schwere Sünde“. Ob Sünde, Scham oder strategisch sinnvoll – die migrationspolitische Abschreckung hat ihren Weg in den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gefunden. DANIEL THYM (DE) analysiert, was die Koalitionäre in der Migrationspolitik versprechen.
Für moralisch fragwürdig halten viele auch einen weiteren Vorschlag aus dem Koalitionsvertrag: eine neue Form der Wehrpflicht. Die Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland lehnt diese ab. Während die Wehrpflicht alle männlichen Bürger verfassungsrechtlich verpflichtet, bleibt das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung auch im Verteidigungsfall geschützt. KATHRIN GROH (DE) skizziert mögliche Wehrpflichtmodelle und deren verfassungsrechtliche Anforderungen.
Nicht nur die Diskussion zur Wehrpflicht wird vor dem Hintergrund von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geführt. Auch andere europäische Länder reagieren weiterhin auf die russische Aggression. Estland änderte nun sein Wahlrecht dahingehend, dass nur noch estnische- und EU-Bürger*innen bei lokalen Wahlen abstimmen dürfen; russische Staatsbürger*innen dürfen dagegen nicht mehr teilnehmen. Was es mit dieser Reform auf sich hat, erläutert RAIT MARUSTE (EN).
Die erneute Blockade des Gazastreifens dauert nun seit Wochen an. Dem israelischen Militär wird vorgeworfen, die Zivilbevölkerung gezielt auszuhungern. In Anschluss an das Interview mit TOM DANNENBAUM (DE) aus dem letzten Newsletter argumentiert ROSA-LENA LAUTERBACH (DE), dass die Verweigerung lebensrettender humanitärer Hilfe für Zivilist*innen gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt.
Die israelische Regierung könnte auch gegen nationales Verwaltungsrecht verstoßen. Der Versuch, sowohl die Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara als auch den Leiter des Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, zu entlassen, sorgte weltweit für Schlagzeilen. ALON HAREL (DE) erklärt, was das für die israelische Verfassungsordnung bedeutet.
Währenddessen ist auch die Türkei mit Entmachtung beschäftigt. LOQMAN RADPEY (DE) analysiert, wie Erdoğan versucht, die pro-kurdische Partei für Gleichheit und Demokratie nahe genug zu halten, um die türkische Opposition zu fragmentieren.
Neben der Opposition wird in der Türkei auch die Anwaltschaft ins Visier genommen. GÜLÇİN BALAMİR COŞKUN und ERTUĞ TOMBUŞ (EN) zeigen, wie ein Fall gegen die Istanbul Bar Association stellvertretend dafür steht, wie autokratische Regime Anwält*innen und deren Interessenvereinigungen kriminalisieren.
Auch Bangladesch scheint sich an einem autoritären Scheideweg zu befinden, seit die autoritäre Politikerin Sheikh Hasina letztes Jahr infolge von Massenprotesten gestürzt wurde. Mit dem Mandat, die Demokratie neu zu starten, hat die Verfassungsreformkommission weitreichende Änderungen vorgeschlagen. ARAFAT HOSEN KHAN (EN) gibt einen Überblick.
Weitreichende Änderungen hat auch der Deutsche Bundestag beschlossen, nach wochenlangen Debatten über Sondervermögen und Schuldenbremse. Nun räumt das geänderte Grundgesetz Bund und Ländern in den kommenden Jahren erheblichen finanziellen Spielraum ein. PHILIP MATUSCHKA (DE) beobachtet, dass die Änderungen mehrere unbeantwortete Fragen aufwerfen und sprachliche Unklarheiten enthalten, die weiterer gesetzlicher Regelungen bedürfen.
Apropos sprachliche Unklarheiten: Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs hat nun einstimmig entschieden, dass „Frau“ unter dem Equality Act nur „biologische“ Frauen meint und trans Frauen nicht einschließt. SARTHAK GUPTA (EN) warnt, dass die Entscheidung den Equality Act unterlaufen und die Rechte von trans Personen diskriminierend einschränken könnte.
++++++++++Anzeige++++++++++++ Ausschreibung: 12 Promotionsstellen am Graduiertenkolleg DynamInt Am DFG-Graduiertenkolleg „Dynamische Integrationsordnung – Europa und sein Recht zwischen Harmonisierung und Pluralisierung“ (DynamInt) der Humboldt-Universität zu Berlin sind 12 reine Promotionsstellen (m/w/d) ausgeschrieben (3/4-Teilzeitbeschäftigung – E 13 TV-L HU). Die Einstellung ist zum 01.10.2025 geplant, Bewerbungsfrist ist der 01.07.2025. Die volle Ausschreibung finden Sie hier.
Ausschreibung: 12 Promotionsstellen am Graduiertenkolleg DynamInt Am DFG-Graduiertenkolleg „Dynamische Integrationsordnung – Europa und sein Recht zwischen Harmonisierung und Pluralisierung“ (DynamInt) der Humboldt-Universität zu Berlin sind 12 reine Promotionsstellen (m/w/d) ausgeschrieben (3/4-Teilzeitbeschäftigung – E 13 TV-L HU). Die Einstellung ist zum 01.10.2025 geplant, Bewerbungsfrist ist der 01.07.2025. Die volle Ausschreibung finden Sie hier.
++++++++++++++++++++++++++++
Unterdessen könnte sich die Tür zur unionsrechtlichen Anerkennung der Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Personen weiter öffnen. Generalanwalt de la Tour sieht in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache C-713/23 eine entsprechende Verpflichtung der Mitgliedstaaten. FULVIA RISTUCCIA (EN) erläutert, was hinter den Anträgen steckt und wo der Generalanwalt noch weiter hätte gehen können.
Auch ein US-Bezirksgericht steht vor großen Fragen: Hat Meta gegen das Kartellrecht verstoßen, als es WhatsApp und Instagram kaufte? SARAH HINCK (EN) schaut sich den Fall an und vergleicht ihn mit dem sich unionsrechtlich entwickelnden Ansatz zur Fusionskontrolle.
Auch bei digitalen Diensten entwickelt sich das Unionsrecht weiter. Der Digital Services Act ist seit über einem Jahr in Kraft. Ist er dem zunehmenden politischen Einfluss der Tech-Giganten gewachsen? NIKOLAUS VON BERNUTH (EN) bewertet, welchen Risiken der DSA ausgesetzt ist, wenn Plattformen die Vorschriften umgehen.
Nicht nur der DSA veranschaulicht, dass „der Vorrang ein ‚existentielles Erfordernis‘ des EU-Rechts“ ist, wie Pierre Pescatore 1973 formulierte. Illiberale Regierungen und politisch vereinnahmte Gerichte sind ein weiteres (folgenreiches) Beispiel. Anlässlich der neuen Stellungnahme von Generalanwalt Spielmann in der Rechtssache C-448/23 argumentiert GIACOMO DI FEDERICO (EN), dass der EuGH klarstellen sollte, dass es für beides wenig Raum gibt.
Der Freistaat Thüringen kämpft zwar (noch) nicht mit einem „captured court“, aber mit einem blockierten Richterwahlausschuss – ein Zustand, der zunehmend untragbar wird. JULIANA TALG und FABIAN WITTRECK (DE) zeigen, warum der Lösungsvorschlag der Justizministerin in eine Sackgasse führt – und wie eine wirksame Gegenstrategie aussehen könnte.
Hier lässt sich von Lateinamerika lernen, das schon lange für eine unabhängige Justiz kämpft. Im Interview mit der Redaktion unseres Partners Agenda Estado de Derecho spricht MARGARET SATTERTHWAITE (EN),UN-Sonderberichterstatterin für die Unabhängigkeit von Richtern und Rechtsanwälten, über kreative Ansätze und die strukturellen Herausforderungen, vor denen Justizsysteme (nicht nur) in Lateinamerika stehen.
In einem weiteren Gespräch mit unserem Partner AED erklärt OSVALDO ZAVALA GILER (EN), der erste lateinamerikanische Kanzler des Internationalen Strafgerichtshofs, wie globale Gerechtigkeit trotz Cyber-Bedrohungen gestärkt werden kann – und welche zentrale Rolle Lateinamerika dabei spielt.
Diese Woche haben wir das von Elena Izyumenko herausgegebene Symposium zu „Intellectual Property and the Human Right to a Healthy Environment“ (EN) abgeschlossen. EVA MEYERMANS SPELMANSuntersucht, wer in der Fast Fashion Industrie angesichts der Klimakrise für den Schutz der Menschenrechte verantwortlich ist, und analysiert die entsprechende Strategie der EU. MARTIN SENFTLEBEN schaut sich Wege an, wie sich Mode-Upcycling rechtlich fördern lässt – Wege, die das Markenrecht derzeit blockiert. IRENE CALBOLI beschreibt die rechtlichen Herausforderungen, mit denen unabhängige Upcycler konfrontiert sind, weil ihre Produkte wohl gegen geistige Eigentumsrechte verstoßen. PÉTER MEZEI analysiert Upcycling aus urheberrechtlicher Sicht. LÉON DIJKMAN prüft, ob und wie das Patentrecht Technologien für den Umweltschutz fördern oder aber behindern kann. HEIDI HÄRKÖNEN verknüpft urheberrechtlichen Schutz mit nachhaltiger Entwicklung und Kreislaufwirtschaft. Und schließlich schließt ELENA IZYUMENKO das Symposium mit einer Reflektion zur Abwägung zwischen dem Recht auf geistiges Eigentum und dem Recht auf eine gesunde Umwelt ab.
Heute Abend wird der Sarg von Papst Franziskus verschlossen und versiegelt, morgen beginnt die Trauerfeier. Am Dienstag treten die Kardinäle zusammen, um den Termin für das Konklave festzulegen. Das Konklave beginnt übrigens traditionsgemäß mit den Worten „extra omnes“: Alle raus, nur die wahlberechtigten Kardinäle dürfen bleiben. Manchmal fühlt sich das Völkerrecht auch eher wie „extra omnes“ als „erga omnes“ an – exklusiv statt universell. Doch diesmal klappt „erga omnes“ ganz gut. Wladimir Putin wird der Trauerfeier fernbleiben – dank des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs könnte sein Besuch in einer belgischen Gefängniszelle enden.
*
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als Email zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.