Das Öffentliche im Öffentlichen Recht
Post-verfassungsstaatliche Depression und wie man sie überwindet
Letzte Woche wurde mir die Ehre zuteil, von der juristischen Fakultät der Universität Münster zum Doktor der Rechte ehrenhalber promoviert zu werden. Ich habe mich wahnsinnig gefreut darüber, nicht nur, aber auch, weil dies tatsächlich der erste akademische Grad ist, den ich je erworben habe. Ich gehöre ja noch einer Jurist*innengeneration an, die ihr Studium mit einem Staatsexamen im ganz wörtlichen Sinne abgeschlossen hat. Dass ich erfolgreich Jura studiert habe, hat mir der Freistaat Bayern bescheinigt, nicht die Ludwig-Maximilians-Universität München. Die letzte akademische Äußerung zu mir und meinen Leistungen war, wenn ich mich recht entsinne, mein großer Strafrechtsschein.
Ich hatte Mitte der 90er Jahre in München bei Peter Landau angefangen, über den „Begriff der Rechtsidee“ zu promovieren, hatte mich eine Zeitlang bemüht, Rudolf Stammlers und Hermann Cohens Schriften zu studieren – aber ziemlich bald festgestellt, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Ich begriff Gott sei Dank ziemlich bald, dass ich niemals dazu irgendetwas aufgeschrieben kriegen werde, was das Opfer von drei bis fünf Jahren Lebenszeit lohnt und am Ende mehr als vier Leute auch nur bemerken, geschweige denn lesen werden. Deswegen brach ich meine wissenschaftliche Laufbahn ab und bog in den Journalismus ab, wo es schließlich ebenfalls darum geht, interessante Wahrheiten herauszufinden und darüber Texte zu schreiben.
Meine Verbindung zur Rechtswissenschaft, insbesondere zur Wissenschaft vom öffentlichen Recht, hatte ich damit aber noch lange nicht abgebrochen. Ich hatte gerade als Jungredakteur beim Handelsblatt angefangen, als beim Bundesverfassungsgericht die Nachfolge von Paul Kirchhof im Zweiten Senat anstand, die ein gewisser Udo Di Fabio antreten sollte. Das war eine große Geschichte für das Handelsblatt, in dessen ansonsten an Politikern und Unternehmenslenkern interessierter Redaktion Paul Kirchhof eine gewaltige Reputation genoss. Wer war das, der ihm nachfolgen sollte? Ich rief meine alten Freunde aus München an, die in der Wissenschaft geblieben waren, und ließ es mir erklären.
Ich war Politikjournalist, recherchierte zu Politics und Policy, aber was mich eigentlich interessierte, war die Polity. Die öffentliche Sache, was sie konstituiert, was sie demokratisch hält. Die Wissenschaftler*innen , die sich mit dem öffentlichen Recht beschäftigen, so meine Vorstellung, verhalten sich zu dieser demokratischen öffentlichen Sache wie Ingenieur*innen zur Maschine – das sind die Leute, die die Institutionen der Demokratie berechnen, bauen und bedienen können, die konstitutiven Regeln, die das Verhalten der Akteure in ihr berechenbar machen und ihr Dauer und Stabilität verleihen und dabei den Raum der kollektiv-verbindlichen Entscheidung offen und vielfältig halten. Da ist Wissen, das in die Öffentlichkeit gehört, das unverzichtbar ist, um zu verstehen, wie und warum das alles funktioniert und was da überhaupt vor sich geht.
Ich war Journalist geworden. Ich war kein Wissenschaftler mehr – aber ich wollte schon noch wissen, was die wissen. Also, so meine Schlussfolgerung, frage ich sie halt, was sie wissen. So habe ich einen nicht geringen Teil meines Journalismus betrieben: Juraprofs anrufen. Die haben fast immer etwas Wissenswertes zu sagen.
Dann habe ich beim Handelsblatt gekündigt und den Verfassungsblog gegründet. Dabei folgte ich im Grunde der gleichen Logik: Liebe Juraprofs, das ist von größter Relevanz für die Öffentlichkeit, was ihr da wisst, also schreibt es auf, macht es zugänglich, öffnet euch für die Öffentlichkeit, und bedient euch dazu am besten dieses praktischen kleinen Blogs, den ich hier gerade gegründet habe.
Ziemlich parallel zur Gründung des Verfassungsblogs 2009/2010 begannen sich die Krisenzeichen zu mehren, die darauf hindeuteten, dass da was ins Rutschen und Bröckeln geriet mit dieser Vorstellung rechtswissenschaftlichen Demokratie-Ingenieurtums – das Post-9/11-Jahrzehnt ging gerade erst zu Ende, die Zeit der Rettungsfolter, des Bürgeropfers, des Feindstrafrechts, alles in die Welt und die höchst faszinierte Öffentlichkeit getragen von und aus der Wissenschaft vom öffentlichen Recht.
Dann kam die Finanzkrise, der Konflikt zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht brach aus, die Euro- und Staatsschuldenkrise – und die professoral informierte und inspirierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts begann plötzlich von Stichwörtern wie Souveränität und Identität zu wimmeln. Und im Heckstrudel der Finanzkrise, scheinbar weit weg, im sogenannten Osteuropa kehrte Viktor Orbán an die Macht zurück, verfügte dank der Bizarrheiten des ungarischen Verfassungsrechts über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und damit nicht nur die Macht, sondern das Recht, die Institutionen der Demokratie, die Verfassung als Werkzeug zur Abschaffung der Demokratie einzusetzen, zur Errichtung eines Regimes, das auf demokratischem Weg faktisch nicht mehr abwählbar ist. Und Orbán war es dann, der in Deutschland die sogenannte Flucht- und Migrationskrise auslöste, Angela Merkels angebliche Grenzöffnung und die sogenannte „Herrschaft des Unrechts“, ein Mythos, der maßgeblich von Rechtswissenschaftler*innen formuliert und verbreitet wurde, obwohl er für jede*n, der ein bisschen was von europäischem Migrationsrecht versteht, als vollkommener Humbug von Anfang an offen zu Tage lag.
Verfassungsrecht ist Verfassungspolitik, und Verfassungspolitik ist Politik. Da werden Herrschaftsinteressen konzipiert, artikuliert und durchgesetzt. Und die Rechtswissenschaft ist mitten drin. War eigentlich, wie mir zunehmend klar wurde, die ganze Zeit schon mitten drin, schon in den 90er Jahren während meines Jurastudiums, als der erwähnte und beim Handelsblatt so innig verehrte Paul Kirchhof am Bundesverfassungsgericht das Maastricht-Urteil schrieb und die ganzen Steuergesetze kippte und das ererbte Vermögen des westdeutschen Bürgertums vor der Zumutung in Sicherheit brachte, zur Finanzierung der Wiedervereinigungslasten herangezogen zu werden.
++++++++++Anzeige++++++++++++
The Handbook of Constitutional Law is the first comprehensive academic presentation of German constitutional law by some of the country’s leading constitutional scholars. Its main purpose is to foster transnational constitutional dialogue. The foreign reader will be introduced to German constitutional law, facilitating access and understanding through points of contact under international and comparative law, and through reflecting on the preconditions and the legal and cultural conditions of the German discussion. Available here.
++++++++++++++++++++++++++++
Das ist alles lange her und erscheint im Rückblick und verglichen damit, was wir in diesen Tagen erleben, geradezu idyllisch. Wie die ersten Windböen, die dem eigentlichen Wolkenbruch vorausgehen und an die man sich mitten in der Katastrophe kaum mehr erinnert. Aber man soll sich vor Naturmetaphern hüten. Das ist alles menschengemacht.
Die Katastrophe ist da, und sie passiert so schnell und umfassend und fundamental, dass man es trotz aller Vorzeichen und Vorboten kaum fassen kann. Das Völkerrecht, das Verbot von Angriffskrieg, Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die internationale Strafgerichtsbarkeit – das alles wird nicht einfach nur gebrochen, wie das Recht halt immer und permanent gebrochen wird, sondern ist einfach egal. Auch und gerade in Deutschland. Für die Bundesregierung und den Großteil der veröffentlichten Meinung in Deutschland ist das Völkerrecht offenbar überhaupt kein normativer Faktor mehr gegenüber der völlig unverhohlen so genannten Staatsräson. Das interessiert überhaupt nicht mehr.
In den Vereinigten Staaten, dem ältesten demokratischen Verfassungsstaat der Erde, dem Ort, an dem vor einem Vierteljahrtausend die Idee einer durch konstitutive Regeln zusammengehaltenen demokratischen Republik freier und gleicher Bürger erfunden wurde und von dem seither alle modernen Demokratien, sogar die französische, ihre maßgeblichen Impulse erhalten haben – was da gerade zugrunde geht, ist buchstäblich unfassbar. Das ist mit den Begriffen moderner Politik- und Staatslehre nicht mehr zu fassen, scheint mir. Welchen Reim soll man sich auf Elon Musks Zerstörungskampagne durch die Behörden und Ministerien denn machen? Welche Rationalität soll man hinter dem massenhaften und fortlaufenden Verschwindenlassen von Menschen durch Leute, die von maskierten Gangstern niemand unterscheiden kann und niemand unterscheiden können soll, vermuten?
Wie soll man sich erklären, dass der Oberste Gerichtshof dem Antrag der Regierung, eine einstweilige Anordnung eines Bundesgerichts außer Kraft zu setzen, die die selbe Regierung zuvor offen und unverhohlen ignoriert hat, und zwar in einem Fall, in dem es um das Schicksal von sechs Menschen geht, die die Regierung in den Südsudan und damit in den nahezu sicheren Tod deportiert hat, einfach nur weil sie es kann – wie soll man sich erklären, dass der Oberste Gerichtshof einem solchen Antrag nicht nur stattgibt, sondern das auch noch ohne ein einziges Wort der Begründung und Rechtfertigung? Wie muss man sich das vorstellen, was sich ein solcher Oberster Gerichtshof über seinen Status im Institutionengefüge des amerikanischen Verfassungsstaates selbst erzählt?
Mir fällt dazu buchstäblich nichts mehr ein, und den amerikanischen Verfassungsrechtler*innen, mit denen ich seither über diesen Vorgang gesprochen habe, eigentlich auch nicht. Das ist nicht zu fassen.
Womöglich ist das gar nicht nur die liberale Demokratie, wie sie seit 1945 vermeintlich so selbstverständlich geworden ist, die da gerade kaputt geht bzw. kaputt gemacht wird – sondern die Vorstellung von rationaler, bürokratischer Herrschaft mit ihren Behörden, Kompetenzen, Experten, Akten und Hierarchien, wie wir sie von Max Weber als Kennzeichen und Voraussetzung des modernen Staates gelehrt bekommen haben. Fast scheint es, um einen Gedanken von Tine Stein zu zitieren, als kehre da eine Art neo-patrimoniale Herrschaft jetzt wieder auf die Bühne zurück, auf persönliche Loyalität und Treueverhältnisse gegründete, neo-feudale Milliardärs-Fiefdoms, die ihre Klienten, Dienstboten und Hintersassen versorgen und von ihnen versorgt werden, sich wechselseitig mit Raub- und Beutezügen überziehen und auf jede Art von rationaler Herrschaftsbegründung pfeifen, von republikanischer Freiheit und Gleichheit ganz zu schweigen.
Vielleicht geht tatsächlich dem modernen, auf kolonisierbaren Raum und fossile Energien gegründeten Staat da buchstäblich gerade der Saft aus.
Wenn das so ist – was macht das mit der Wissenschaft vom öffentlichen Recht und der an ihr interessierten Öffentlichkeit?
Die naheliegende Antwort lautet: Depression. Man beugt sich, so man es überhaupt noch aus dem Bett rausschafft, weiter über das Gewohnte, erforscht und unterrichtet die Institutionen wie eh und je, bejammert den Zustand der Welt und hofft, dass es trotzdem irgendwie alles so weitergeht, denn was soll man denn sonst machen. Was man in der Völkerrechtsvorlesung den Studierenden eigentlich über die Welt da draußen noch beibringen kann, ist zwar immer schwerer zu beantworten, und ich höre von einigen Professor*innen aus den USA, dass sie schlicht und einfach aufgehört haben, amerikanisches Verfassungsrecht zu unterrichten, weil das, was sie da lehren, keine Wirklichkeit mehr beschreibt. Aber zumindest im deutschen öffentlichen Recht kann man sich immer noch wechselseitig versichern, dass das doch alles gottlob noch weit weg ist und hierzulande doch alles ganz anders und diesen ganzen schlimmen Entwicklungen eigentlich und hoffentlich und ganz bestimmt das Problem von anderen Leuten sind und bleiben werden.
Ich würde empfehlen, nach weniger naheliegenden Antworten zu suchen. Nach Antworten, die dann vielleicht durchaus auch mal seinerseits jenseits der modernen rationalen Verwaltungs- und Verfassungsstaatlichkeit liegen. Nach Möglichkeiten, Räume der Freiheit und Gleichheit zu öffnen und offen zu halten, die der Staat vielleicht weniger dringend schützen und ermöglichen muss, als wir uns das vorzustellen über die letzten zweieinhalb Jahrhunderte angewöhnt haben. Räume der Autonomie, der Selbstverwaltung.
Die Universität zum Beispiel. Müssen wir die eigentlich als einen staatlichen Verwaltungsapparat konzipieren, wie wir das im Augenblick im Regelfall gewohnt sind zu tun? Deren Präsidentin von der Bildungssenatorin und hinter dieser dem Regierenden Bürgermeister Weisungen erteilt bekommt, wie sie mit protestierenden Studierenden zu verfahren hat? In der bis an die Zähne bewaffnete und den Zugang zum Universitätsgebäude kontrollierende Polizisten der Hochschulpräsidentin, die sie zum Abziehen auffordert, nicht einmal Rede und Antwort zu stehen brauchen? Wie hätte man sich eine tatsächlich autonome, eine freie Universität vorzustellen, deren Mitglieder sich wechselseitig die Freiheit von Forschung und Lehre garantieren? Und gibt es da nicht auch im geltenden bundesdeutschen Verfassungsrecht, in den Freiheitsgrundrechten des Grundgesetzes vielleicht den einen oder anderen Anknüpfungspunkt, den zu vertiefen und zu entfalten sich rechtswissenschaftlich lohnen könnte?
Oder: die Kommunen. Denen geht es schlecht, das wissen wir alle. Sie müssen mit immer unzulänglicherer Mittelausstattung immer mehr Verwaltungsaufgaben wegschaffen. Sie werden zu immer größeren Verwaltungseinheiten zusammengefasst, aber wer sich in seinem Dorf oder seiner Nachbarschaft um das Gemeinsame kümmern möchte, muss so viele Anträge stellen, dass man es dann meistens lieber gleich bleiben lässt. Das ist zwar alles wahnsinnig rational, aber versteht kein Mensch mehr.
Aber wenn man nach Ungarn, wenn man in die USA schaut: sind es nicht auch jetzt schon die Städte, die sich am erfolgreichsten der Re-Patrimonialisierung der Herrschaft entziehen? Budapest Pride am vorletzten Samstag, 200.000 Leute, die sich von Viktor Orbán das solidarische Demonstrieren auch durch Recht und Gesetz und Staatsverfassung einfach nicht verbieten lassen – und damit erfolgreich sind? In Los Angeles gehen die Leute gegen die Deportation ihrer Nachbarn auf die Straße, in New York gewinnt ein linker Muslim die demokratischen Primaries. Wie müsste, wie könnte eine Stadt verfasst sein, die in einem neo-patrimonial zerfallenden Staat Räume der Freiheit erfolgreich verteidigt? Was könnte die kommunale Selbstverwaltungsgarantie des Grundgesetzes, wenn man sie von der staatsfixierten Verfassungsorthodoxie mal ein bisschen ablöst, dafür so alles hergeben?
Vor zehn Jahren wären solche Fragen sicherlich noch als anarchistische Pipe-Dream-Spinnereien abgetan worden. Aber wie alles andere auch, so ändert sich auch dies gerade rapide. Ich finde, das sind wahnsinnig interessante Fragen. Ich glaube, viele andere auch. Je mehr der Staat als Garant der Freiheit ausfällt, desto mehr wird die Organisation von Freiheit außerhalb oder gar gegen den Staat zu einer schieren Notwendigkeit. Da entsteht ein dringender, ein vitaler Bedarf nach neuen Ideen, nach neuem Wissen. Da gibt es ungeheuer viel zu tun für Leute, die von Berufs wegen über öffentliches Recht nachdenken. Dafür gibt es eine Öffentlichkeit. Ich werde weiterhin meine ganze Lebenskraft dafür einsetzen, zu helfen, sie herzustellen.
Dieser Text beruht auf meinem Dankes- und Festvortrag aus Anlass der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Münster am 1. Juli 2025.
*
Editor’s Pick
von MARIE MÜLLER-ELMAU
 Wann waren Sie das letzte Mal auf einer walking tour? Als ich in New York gelebt habe, habe ich diese besonderen Spaziergänge wiederentdeckt. Jeden Sonntag führten uns lokale Doktorand*innen oder Künstler*innen, oft organisiert in kleinen Kollektiven, durch die unterschiedlichen Viertel der Stadt. Sie erzählten von der Geschichte des Viertels, seiner Architektur und seinen politischen Kämpfen. Mein Verhältnis zu New York hat sich dadurch fundamental verändert. Das Gehen und Zuhören haben aus einer kulturellen Abstraktion etwas Konkretes gemacht. Zurück in Berlin möchte ich mir diese Praxis bewahren – und weitergeben. Dieses Wochenende lasse ich mir von Biologiestudent*innen etwas über die ökologische Komposition des Tempelhofer Feldes erklären.
Wann waren Sie das letzte Mal auf einer walking tour? Als ich in New York gelebt habe, habe ich diese besonderen Spaziergänge wiederentdeckt. Jeden Sonntag führten uns lokale Doktorand*innen oder Künstler*innen, oft organisiert in kleinen Kollektiven, durch die unterschiedlichen Viertel der Stadt. Sie erzählten von der Geschichte des Viertels, seiner Architektur und seinen politischen Kämpfen. Mein Verhältnis zu New York hat sich dadurch fundamental verändert. Das Gehen und Zuhören haben aus einer kulturellen Abstraktion etwas Konkretes gemacht. Zurück in Berlin möchte ich mir diese Praxis bewahren – und weitergeben. Dieses Wochenende lasse ich mir von Biologiestudent*innen etwas über die ökologische Komposition des Tempelhofer Feldes erklären.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
 Diese Woche gab es noch mehr bei uns zu feiern, und zwar eine Doppelspitze für den Verfassungsblog: Verena Vortisch wird neben dem Gründer Maximilian Steinbeis nun auch Teil der Geschäftsführung. Verena ist seit Juni 2024 als Projektmanagerin bei uns und hat mit ihrer Tatkraft und Erfahrung bereits ungeheuer viel angestoßen. Mit der Doppelspitze – und Ihrer fortlaufenden Unterstützung – setzen wir die nötigen Energien frei, um das, was vor uns liegt, zu schaffen.
Diese Woche gab es noch mehr bei uns zu feiern, und zwar eine Doppelspitze für den Verfassungsblog: Verena Vortisch wird neben dem Gründer Maximilian Steinbeis nun auch Teil der Geschäftsführung. Verena ist seit Juni 2024 als Projektmanagerin bei uns und hat mit ihrer Tatkraft und Erfahrung bereits ungeheuer viel angestoßen. Mit der Doppelspitze – und Ihrer fortlaufenden Unterstützung – setzen wir die nötigen Energien frei, um das, was vor uns liegt, zu schaffen.
Und vor uns liegt einiges, wie MAXIMILIAN STEINBEIS oben beschrieben hat. Dass es immer mehr Bedarf gibt, Freiheit auch jenseits des Staates zu organisieren, haben diese Woche vor allem wieder die USA gezeigt.
Neu ist zwar nicht, dass die Trump-Regierung ganz offen eine besorgniserregende Einwanderungspolitikbetreibt: Mahmoud Khalil, Kilmar Ábrego García und Rumeysa Ozturk sind nur einige von vielen Beispielen. Weniger offensichtlich ist eine Entwicklung, auf die BIJAL SHAH (EN) hinweist: Der Supreme Court habe die richterliche Kontrolle der Exekutive in Migrationsfragen geschwächt – indem er das Verwaltungsrecht aushebelt.
Ausgehebelt hat der Supreme Court nun auch Kinderrechte, in Mahmoud v. Taylor: Eltern dürfen ihre Kinder nun aus dem Unterricht nehmen, sobald LGBTQAI+-Personen im Lehrplan thematisiert werden. Mit dieser Ausweitung von Elternrechten habe der Gerichtshof indirekt ein Werteverständnis installiert, das Heteronormativität und religiösen Fundamentalismus fördere, argumentiert JEREMIAH CHIN (EN).
SARAH MEDINA CAMISCOLI (EN) schließt daran an: De facto erlaube das Gericht es öffentlichen Schulen damit, Toleranz zu untergraben, das Gleichbehandlungsgebot zu missachten und Kinderrechte als Testfall für autoritäre Maßnahmen zu instrumentalisieren – die Entscheidung schaffe so die Grundlage, um weitere Grundrechte zurückzubauen.
Doch nicht nur der Supreme Court erweist sich zunehmend als unzuverlässig dabei, Freiheitsräume zu sichern. Auch auf Bundesgerichte ist rechtsstaatlich immer weniger Verlass, seit diese konservativ dominiert werden. DUNCAN HOSIE (EN) erklärt, warum progressive Kräfte ihre Energie neu ausrichten und auf „Widerständigkeit durch Zurückhaltung“ setzen sollten.
Trumps jüngste Richternominierung gibt Hosie recht: Emil Bove III, ehemaliger Trump-Anwalt und Loyalist (der nicht mal mehr vorgibt, sich für die Verfassung zu interessieren), soll nun Richter an einem US Court of Appeals werden. Trump könnte noch hunderte Richter*innen ernennen – und damit die Langzeitstrategie der Neuen Rechten fördern, die Justiz zu unterwandern. LAURA K. FIELD (EN) zeigt, wie die intellektuelle Avantgarde dieser Bewegung dies bereits still und leise vorbereitet.
All das wäre eigentlich Grund genug für die übrige US-amerikanische Justiz, in den Streik zu treten. Ihre spanischen Kolleg*innen haben es vorgemacht: Obwohl Richter*innen nicht streiken dürfen, gingen sie auf die Straße – gegen die erste Justizreform seit der demokratischen Wende in Spanien. Doch ist die Reform wirklich der einzige Grund? ANTONIO ESTELLA DE NORIEGA (EN) vermutet, dass eigentlich ein Amnestiegesetz dahintersteckt.
Während Spanien seine streikenden Gerichte vermisst, sucht ein Verbrechen nach einem Gericht: Russland verletzt mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine das Gewaltverbot der UN-Charta, doch bleibt dies strafrechtlich ungesühnt – bis jetzt. Ein Sondertribunal des Europarats will die Verantwortlichen nun zur Rechenschaft ziehen. Für ALEXANDER ELFGEN (DE) läutert dies eine neue Ära für internationale Gerechtigkeit ein.
In Deutschland wiederum suchen immer häufiger keine Verbrechen nach einem Gericht: Sogenannte „SLAPPs“ („strategic lawsuits against public participation“) nutzen gerichtliche Verfahren als Druckmittel, um Personen zum Schweigen zu bringen – eine Strategie, die in den letzten Jahren vor allem in rechten Kreisen immer beliebter wird. Das Bundesjustizministerium hat nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, um die Anti-SLAPP-Richtlinie der EU umzusetzen. Doch viel würde das Gesetz nicht ändern, meint JOHANNES MAURER(DE), und mahnt im Übrigen zur Vorsicht – schließlich sei das Recht, Ansprüche geltend zu machen, ein hohes Gut.
Als Strategie gegen rechte Strategien wird das Parteiverbot wieder intensiv diskutiert, vor allem seit der SPD-Bundesparteitag die Vorbereitung eines AfD-Parteiverbotsverfahrens beschlossen hat. Doch was würde dann eigentlich mit den Mandaten der AfD-Abgeordneten im Europäischen Parlament, im Bundestag und in den Landtagen passieren? TILL PATRIK HOLTERHUS und CASPAR ALEXANDER WEITZ (DE) geben Antworten.
++++++++++Anzeige++++++++++++
Out now! ✨

Anmol Jain & Tanja Herklotz (eds.)
Indian Constitutionalism at Crossroads: 2014-2024
Narendra Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP) has governed India since 2014, marking a decade of challenges to various aspects of India’s democracy and constitutional system. While the last decade may not have left many conspicuous signs textually, the soul of India’s constitutional system has suffered several dents. The ruling government has launched, quite successfully, a project of redefining India, its constitutional identity, and its vision. This edited volume explores these multifaceted challenges and assesses the current state of Indian Constitutionalism.
Now available as _soft copy _(open access) and in print!
++++++++++++++++++++++++++++
Fast hätte auch Ursula von der Leyen ihr Mandat im Europäischen Parlament verloren. Doch das Misstrauensvotum wurde gestern mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. ALBERTO ALEMANNO (EN) nimmt das zum Anlass, die sich entfaltende Doppelrolle des Misstrauensvotums zu untersuchen: als rechtliches Kontrollinstrument und politisches Dialogmittel zwischen den Institutionen.
Innerhalb der Institutionen hapert es oft am Dialog, vor allem wenn es um die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geht, genauer: die EU-Sanktionen gegen Russland. Bislang haben sich die konventionellen Mittel gegen Ungarns Vetostrategie als wirkungslos erwiesen. LUCIA SERENA ROSSI (EN) schlägt deshalb vor, Artikel 7 EUV neu auszulegen.
Eine neue Auslegung scheint der EU dagegen nicht zu reichen, um mit den digitalen Entwicklungen Schritt zu halten. Die Kommission hat jetzt Vorschläge veröffentlicht, um die DSGVO zu reformieren. HANNAH RUSCHEMEIER (EN) erinnert daran, dass Reformen nur dann effektiv sein können, wenn sie nicht dem aktuellen Deregulierungstrend folgen – sondern die strukturellen Schwächen angehen.
Nur wenig Erfolg war schließlich einer Reform beschert, mit der das Land Berlin die prekären Arbeitsbedingungen junger Wissenschaftler*innen verbessern wollte. Eine im Berliner Hochschulgesetz eingeführte Entfristungsregelung wurde vom Bundesverfassungsgericht nun für verfassungswidrig erklärt. THOMAS GROẞ hat sich den Beschluss angesehen und meint: Einige Teile sind nicht nur dürftig argumentiert, sie zementieren im Ergebnis auch die Personalstruktur der Ordinarienuniversität.
Diese Woche haben wir gemeinsam mit dem Sabin Center for Climate Change Law der Columbia University ein Symposium zu „Human Rights Protection in the Climate Emergency: The Inter-American Court of Human Rights’ Advisory Opinion No. 32“ (EN) gestartet: Am 3. Juli 2025 hat der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte seine Advisory Opinion No. 32 veröffentlicht – das bisher wichtigste und progressivste Dokument eines internationalen Gerichtshofs zur Klimakrise.
MARIA ANTONIA TIGRE, MAXIM BÖNNEMANN, KOREY SILVERMAN-ROATI machen den Auftakt und fassen zehn Kernaussagen der Advisory Opinion zusammen. LENA RIEMER und LUCA SCHEIDargumentieren, dass die Advisory Opinion die rechtlichen Maßstäbe für klimabedingte Vertreibung fundamental verändert. Nächste Woche geht es weiter.
So wie es eben immer weiter geht. Jede Woche fügen wir der Betriebsanleitung unserer materialmüden, demokratischen Maschinen ein paar Absätze hinzu, stehen staunend oder frustriert davor, hören sie rattern und röcheln – und hoffen, dass sie trotz allem weiterlaufen. Es ist und bleibt mühsam, aber es lohnt sich, das Kleingedruckte zu lesen, wenn wir nicht nur darauf hoffen wollen.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.




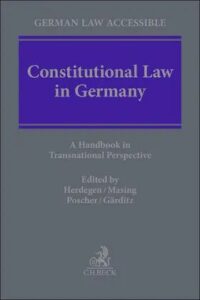
Sehr geehrter Herr Dr. jur. h.c. Steinbeis,
Glückwunsch zur Ehrendoktorwürde wie Respekt zu fünfzehn Jahren Verfassungsblog einschließlich den leidenschaftlichen Rückblick auf die verfassungspolitischen Entwicklungen dieser Zeit.
Meine Rückfrage, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, öffentlichrechtliche Wissenschaft sei eine Art Ingenieurskunst für die Maschine des Gemeinwesens? Auch im Abspann der engagierten Wochenschau taucht die Maschinen-Metapher nochmal auf.
Ließe sich “polity” auch anders bebildern, beschreiben und verstehen?
Für den Verfassungsblog Ihnen, Frau Vortisch und Team alle guten Wünsche
mit besten Grüßen
Bernd Arnold