Die dünne rote Linie
Fünf Fragen an Robert Brockhaus
Die aktuelle Politik der Bundesregierung gegenüber afghanischen Menschenrechtler*innen, Ortskräften und anderen Geflüchteten mit deutscher Aufnahmezusage ist – ganz buchstäblich und im juristischen Sinne – ein Verbrechen. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, das der Rechtsanwalt (und frühere Verfassungsblog-Redakteur) Robert Brockhaus im Juli für Pro Asyl und das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte e.V. erstellt hat. Die verantwortlichen Politiker*innen und Beamt*innen liefern diese Menschen nach Monaten des Wartens auf ein Visum in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad aktiv oder passiv der Verhaftung und Abschiebung aus und bringen sie damit in konkrete Gefahr für Leib und Leben. Sie dürften danach den Tatbestand der Aussetzung Hilfloser nach § 221 StGB erfüllen und sich persönlich strafbar machen.
Wem der deutsche Staat eine bestandskräftige Aufnahmezusage erteilt, dem muss er dann auch ein Visum ausstellen, soweit sich an der Sachlage – im Unterschied zur innenpolitischen Interessenlage – nichts Relevantes geändert hat. Das Verwaltungsgericht Berlin hat sich dazu wiederholt und in unmissverständlicher Klarheit geäußert. Es gibt nach Auskunft von Eva Beyer von der NGO Kabul Luftbrücke aktuell 43 solche Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts. Sie alle stellen fest: Die Bundesregierung ist rechtlich verpflichtet, die Visa auszustellen.
Macht sie aber nicht, in vielen Fällen jedenfalls. Die aktuelle Bundesregierung, laut Artikel 20 Abs. 3 Grundgesetz an Recht und Gesetz gebunden, sieht sich an dieses spezielle Recht und Gesetz offenbar mitnichten gebunden. In einigen dieser Fälle hat das Gericht bereits ein Zwangsgeld von 10.000 Euro gegen die Bundesrepublik Deutschland festgesetzt (ein notorisch zahnloser Tiger, aber immerhin). Exekutiver Ungehorsam heißt der Fachbegriff für diese in den letzten Jahren immer häufigere Art von Politik. Die sogenannte „Ehrenmanntheorie“ (siehe dazu hier, S. 73 ff.), nach der sich der Gehorsam des Staates gegenüber seinen eigenen Gerichten derart von selbst versteht, dass die Frage nach der Zwangsvollstreckung sich gar nicht erst stellen kann – die scheint mir doch allmählich faktisch widerlegt zu sein. Von Ehre hat man in Alexander Dobrindts Bundesinnenministerium offenbar einen ganz anderen Begriff.
++++++++++Anzeige++++++++++++
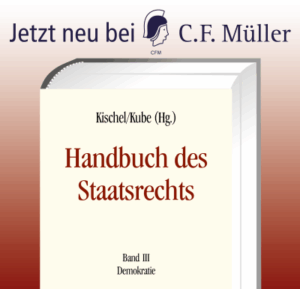
Band III des neuen Handbuchs des Staatsrechts ist der Demokratie gewidmet. Die Beiträge renommierter Staatsrechtswissenschaftler*innen behandeln deren theoretische und verfassungsrechtliche Grundlagen, die politische Willensbildung in der Gesellschaft, den Status der politischen Parteien, die auf der Grenze zwischen Gesellschaft und Staat den Volkswillen in die Staatssphäre hinein vermitteln, sowie das parlamentarisch-demokratische Regierungssystem.
Mehr Informationen hier.
++++++++++++++++++++++++++++
Dort ist man jetzt auf die Idee verfallen, die Aufnahmezusagen durch das ihm unterstellte Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) kurzerhand zurücknehmen zu lassen. Das geht aus einem aktuellen Beschluss des Verwaltungsgerichts Ansbach hervor (Az.: AN 5 S 25.2435), der mir vorliegt. Nach Auskunft von Eva Beyer kann man diesen Fall für die aktuelle Praxis der Bundesregierung durchaus repräsentativ nehmen. Mit einer solchen Rücknahme, so wohl das Kalkül, ist der Verwaltungsakt, durch den sich die Bundesrepublik gegenüber den afghanischen Geflüchteten gebunden hat, erst mal aus der Welt, die Eilbeschlüsse des VG Berlin gehen ins Leere, die Leute können aus ihren Safe Houses in Islamabad hinausgeschmissen werden, auf dass die pakistanische Polizei sie dann zurück nach Afghanistan abschieben und ihr so das Problem auf das Gefälligste vom Hals schaffen möge.
In dem vom VG Ansbach entschiedenen Fall geht es um einen Musiker und eine hochschwangere Gynäkologin (Näheres zu diesem und weiteren Fällen hier). Der Musiker – Musik ist unter der Taliban bekanntlich streng verboten – hatte über Dritte ein Foto eines Haftbefehls gegen ihn erhalten. Seine Gefährdung und die seiner Frau erschien zunächst real und substantiiert – bis es sich das BAMF plötzlich anders überlegte: Die Gefährdungslage, so die Begründung, erscheine auf den zweiten Blick doch nicht so wild. Der Haftbefehl sei nicht im Original vorgelegt worden und damit nicht auf seine Echtheit überprüfbar. Die Aufnahmezusage sei somit von vornherein rechtswidrig gewesen und zurückzunehmen.
Was von dieser Argumentation zu halten ist, formuliert das VG Ansbach so:
„Die Antragsgegnerin behauptet insoweit lediglich unsubstantiiert und nicht nachvollziehbar – ohne sich mit in der Gefährdungsanzeige konkret und zeitlich zuordenbar beschriebenen Bedrohungssituationen, die der Aufnahmezusage zugrundliegen, auseinanderzusetzen – die Annahme einer individuellen, konkreten Gefährdung der Antragsteller sei unzutreffend gewesen. Auch wenn sich für die Antragsteller tatsächlich nach der Machtübernahme durch die Taliban keine konkreten Probleme ergeben haben und keine (weiteren) Übergriffe oder Drohungen erfolgten, ergibt sich hieraus nicht, dass die Aufnahmezusage vom 22. Mai 2024 rechtswidrig, unter Verstoß gegen die Regelungen in der Aufnahmeanordnung des BMI, ergangen wäre, zumal nach der Anordnung des BMI Voraussetzung einer Aufnahmezusage eine individuelle Gefährdung, nicht aber, wie im Rücknahmebescheid behauptet, eine individuelle, konkrete, tätigkeitsbezogene Gefährdungslage ist. Alleine der – wenn auch politisch motivierte – geänderte Maßstab der individuellen Gefährdung im Sinne der Aufnahmeanordnung oder der geänderte Maßstab der für die Begründung dieser Gefährdung geforderten Belege genügt insoweit jedenfalls nicht, die Rechtswidrigkeit der Aufnahmezusage zu begründen.“
Diesen am 10. September ergangenen Eilbeschluss hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 26. September bestätigt (Az.: 19 CS 25.1802). Auch diese Entscheidung liegt mir vor.
++++++++++Anzeige++++++++++++

Transform your career with Loyola Chicago’s top-ranked LLM for International Lawyers, built on the core principles of academic excellence, affordability, and flexibility. Choose from 160+ courses taught by distinguished and engaged faculty, access tailored career support, and gain hands-on experience in the heart of vibrant Chicago, a major legal and financial hub. Loyola’s LLM empowers ambitious lawyers from diverse backgrounds to excel as ethical global leaders.
Curious? Reach out to Insa Blanke, Exec Dir of International LLM and SJD Programs, Loyola University Chicago School of Law.
++++++++++++++++++++++++++++
Es sind die Mitarbeiter*innen des BAMF, die diese Entscheidungen zu fällen und zu verantworten haben. Dort verfügt man über ein Justiziariat, und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses die Frage der Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen nicht sorgfältig geprüft hat. Vor diesem Hintergrund möchten wir diesen Mitarbeiter*innen so etwas wie eine Handreichung zur Verfügung stellen. Wir haben den Rechtsanwalt Robert Brockhaus gebeten, zu beantworten, wie die BAMF-Mitarbeiter*innen vermeiden können, sich strafbar zu machen. Wie gesagt: Wenn die von der Bundesregierung auf diese schändliche Weise im Stich gelassenen Personen jetzt infolge dieser Praxis in akute, konkrete Gefahr für Leib und Leben geraten, dann steht hier ein handfestes Verbrechen im Raum. Die Strafe, die § 221 StGB für den Tatbestand der Aussetzung mit Todesfolge vorsieht, ist Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
1. Robert, wo verlaufen die Grenzen der Strafbarkeit für die Mitarbeiter*innen des BAMF, die Aufnahmezusage in dieser Weise zurücknehmen?
Es gibt verschiedene Strafvorschriften, die in Betracht kommen. Zentral ist die Straftat der Aussetzung, die in § 221 Strafgesetzbuch geregelt ist. Danach macht sich strafbar, wer einen Menschen in eine hilflose Lage versetzt und dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt. Die Bundesrepublik hat den Menschen, um die es hier geht, nach langwierigen Verfahren schwarz auf weiß bestätigt, dass sie in Afghanistan besonders gefährdet sind. Die UN und Menschenrechtsorganisationen haben die Gefährdungslagen für die betroffenen Personengruppen in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wieder in ihren Berichten herausgearbeitet. Nach den Einschätzungen von Mitarbeiter*innen von Nichtregierungsorganisationen, die auch vor Ort tätig sind, hängt es nur vom Zufall ab, wann der erste Mensch mit einer Aufnahmezusage aus Deutschland, der von Pakistan aus nach Afghanistan abgeschoben wurde, von den Taliban misshandelt oder sogar getötet wird.
Dazu muss es aber nicht einmal kommen, um eine strafbare Aussetzung anzunehmen. Schon die schweren psychischen Beeinträchtigungen, die die nach Afghanistan abgeschobenen Menschen erleiden, sind schwere Gesundheitsschädigungen. Wenn jetzt die Aufnahmezusagen widerrufen und die Menschen daraufhin von der pakistanischen Polizei nach Afghanistan abgeschoben werden, dann besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Anfertigen des jeweiligen Widerrufsschreibens und der konkreten Gefährdung des betroffenen Menschen in Afghanistan.
Aus der strafrechtlichen Verantwortung kommt man meines Erachtens nicht mit der Überlegung raus, dass es die pakistanischen Behörden sind, die die Abschiebungen durchführen, denn es wird schon das ganze Jahr über in den Medien darüber berichtet, dass die pakistanischen Sicherheitskräfte Menschen nach Afghanistan abschieben. Die Aufnahmezusagen, welche die Menschen bei sich tragen, haben sie bislang in aller Regel davor geschützt, abgeschoben zu werden. Wer diesen Schutz jetzt entzieht, dem muss klar sein, dass er den Weg zu weiteren Abschiebungen ebnet und die Menschen den Taliban aussetzt. Außerdem hat Deutschland wiederholt und über Jahre seine Verantwortung gegenüber den betroffenen Menschen erklärt und sich entsprechend verhalten, z.B. durch Unterbringung der Betroffenen in Guest Houses in Islamabad. Deshalb sind Vertreter*innen der zuständigen Behörden verpflichtet, Gefahren und Schäden von den Menschen abzuhalten. Rechtliche Grundlage dieser Garantenpflicht ist § 13 Absatz 1 Halbsatz 2 Strafgesetzbuch.
2. Wenn sie tun, was die Bundesregierung von ihnen verlangt – wie realistisch ist dann die Erwartung, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt?
Die Prozesse innerhalb der Staatsanwaltschaft sind von außen schwer einzuschätzen und hängen von vielen Faktoren ab: Welche*r Dezernent*in ist zuständig, wer ist Abteilungsleiter*in, gibt es öffentlichen Druck in die eine oder andere Richtung, wird gegebenenfalls von Dienstvorgesetzten interveniert etc. Gerade in politisch aufgeladenen Konstellationen gibt es eine Reihe von Faktoren, die den Ermittlungsdrang der Staatsanwaltschaft beeinflussen können.
Zunächst einmal ist die Staatsanwaltschaft aber gesetzlich verpflichtet, den Sachverhalt zu erforschen, wenn sie von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält. Ausreichend ist ein sogenannter Anfangsverdacht, also tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass eine Straftat begangen worden sein könnte – keine besonders hohe Hürde. Pro Asyl und das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte e.V. haben bereits Mitte August eine Strafanzeige erstattet und ich gehe erstmal davon aus, dass die Staatsanwaltschaft ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend die Vorwürfe prüft und den Sachverhalt erforscht. Wenn sich herausstellt, dass Menschen, deren Aufnahmezusagen widerrufen wurden, von den pakistanischen Behörden nach Afghanistan abgeschoben werden, dann wäre die Staatsanwaltschaft verpflichtet, den Sachverhalt auch in diese Richtung zu erforschen.
++++++++++Anzeige++++++++++++

Young Democracy Rapporteurs have a plan to renew democracy — will the EU listen?
The Our Rule of Law Foundation, national winner of the 2024 European Charlemagne Youth Prize (Netherlands), unites young Europeans to strengthen democracy and the rule of law. Its latest project, the Our Democracy Report, gathers young Democracy Rapporteurs from across EU member states and Ukraine to urge the European Commission to #TakeDemocracySeriously.
Learn more here.
++++++++++++++++++++++++++++
3. Können sich BAMF-Mitarbeiter*innen darauf berufen, nur Befehle von oben befolgt zu haben?
Nein, auch das Rädchen im Getriebe kann sich strafbar machen. Das gilt auch dann, wenn das Rädchen austauschbar und selbst nicht in der Lage ist, das Geschehen aufzuhalten. Man denke z.B. nur an Irmgard Furchner, die ehemalige Schreibkraft aus dem Konzentrationslager Stutthof, die wegen Beihilfe zu Mord in zigtausend Fällen verurteilt wurde. Die Behauptung, die Schreibkraft hätte sich dienstlichen Anordnungen nicht widersetzen können, wurde dort schon zutreffend verneint. Erst recht kann man als heutige deutsche Beamt*in nicht behaupten, einem unwiderstehlichen Zwang ausgesetzt zu sein, Anordnungen zu befolgen, die einem ein strafbares Verhalten abverlangen.
Der Fall Furchner zeigt außerdem: Die Verfolgungspraxis kann sich mit der Zeit ändern. Heute mag es noch schwer vorstellbar sein, dass Beamt*innen wegen Aussetzung der Afghan*innen angeklagt werden. Das kann sich ändern.
4. Was müssten sie tun, um strafrechtlich auf der sicheren Seite zu sein?
Sich nicht daran beteiligen, dass Menschen mit Aufnahmezusagen aus Deutschland von Pakistan aus nach Afghanistan abgeschoben werden. Erstmal könnten sie ihre Bedenken gegen die Anordnung, Aufnahmezusagen zu widerrufen, gegenüber ihren Vorgesetzten geltend machen. Dazu sind sie beamtenrechtlich auch verpflichtet. Wenn der oder die Vorgesetzte dann erklärt, dass weitergemacht werden soll, müssten sie sich mit den Bedenken an die nächsthöhere Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten wenden. Die Frage ist, wie es weitergeht, wenn die Anordnung dann immer noch aufrechterhalten wird. Prinzipiell sind die Beamt*innen ab diesem Punkt von der Verantwortung befreit. Das gilt aber nicht, wenn das aufgetragene Verhalten strafbar und das für die Beamt*in auch erkennbar ist. Dann besteht die Pflicht, die Anordnung nicht zu befolgen.
5. Dürfen sie ihre rechtlichen Bedenken, wenn sie welche haben, öffentlich machen?
Auch Beamt*innen genießen natürlich den Schutz der Meinungsfreiheit. Sie können ihren Dienstherren kritisieren, auch öffentlich. Gleichzeitig sind sie bei politischer Betätigung zu Mäßigung und Zurückhaltung verpflichtet. Die Rechtsprechung ist hier teilweise recht restriktiv. Um sich nicht angreifbar zu machen, ist es wichtig, dass sie sich erkennbar nicht in der Funktion als Beamt*in, sondern als Privatpersonen äußern.
Von Vorteil ist es auch, wenn Rechtsverstöße zunächst intern gerügt werden. Ändert sich dann nichts, kann man nach dem Gang an die Öffentlichkeit darauf hinweisen, dass man die Kritik zunächst intern vorgebracht hat. Geht es um die Veröffentlichung von bislang nicht bekannten Informationen, ist zu beachten, dass Beamt*innen grundsätzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Prinzipiell sind sie auch dort gehalten, zunächst den Dienstweg zu beschreiten, also Rechtsverstöße zunächst intern zu rügen. Davon gibt es aber Ausnahmen. Bei Informationen über Straftaten kann die Öffentlichkeit unter Umständen auch unmittelbar angerufen werden. Die Einzelheiten sind in § 32 Absatz 1 Nummer 2 des Hinweisgeberschutzgesetzes geregelt. Der direkte Gang an die Öffentlichkeit ist u.a. rechtlich erlaubt, wenn die Gefahr irreversibler Schäden droht oder vergleichbare Umstände eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öffentlichen Interesses darstellen oder wenn Beweismittel unterdrückt oder vernichtet werden könnten.
*
Editor’s Pick
von MORITZ SCHRAMM
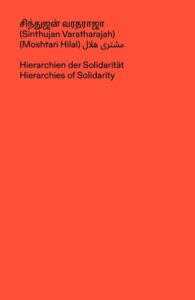
Krisen von Institutionen lassen sich selten durch diese selbst lösen. Frische Ideen kommen häufig aus weniger festgezurrten Kontexten: von jungen Stimmen, institutioneller Routinen entbunden, oder aus Disziplinen wie Kunst, Literatur und Architektur, die gesellschaftliche Veränderungen oft direkter aufgreifen als die Sozial- und Rechtswissenschaften.
So auch das Buch Hierarchien der Solidarität | Hierarchies of Solidarity von Sinthujan Varatharajah und Moshtari Hilal: Es dokumentiert einen Dialog zwischen den beiden Autor:innen und Aktivist:innen aus Berlin und Hamburg. Der Austausch ist zugänglich und zugleich analytisch scharf, pointiert, ohne platt zu wirken (to be fair, frei von geisteswissenschaftlichem Habitus ist das Buch freilich nicht). Das Ergebnis ist bemerkenswert: nuancierte Empathie, Kritik, die sich Vereinfachung verweigert. Nicht jede These überzeugt auf Anhieb, und das Buch bietet auch keine unmittelbar anwendbaren Lösungen. Aber die Denkweise, die Absage an vereinfachende Nichtlösungen und an simple Verantwortungszuschreibungen eröffnen etwas anderes: einen Raum, gesellschaftliches Miteinander jenseits von Schlagworten neu zu denken.
Sinthujan Varatharajah, Moshtari Hilal – Hierarchien der Solidarität | Hierarchies of Solidarity, Wirklichkeit Books, Berlin 2024
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
Der Friedensnobelpreis ging heute nicht an Trump, sondern an die venezolanische Politikerin María Corina Machado. Nachdem Israel und die Hamas der ersten Phase des US-Friedensplans zugestimmt hatten, warb Trump gestern nochmal für sich: „I don’t know what they’re going to do, but I know nobody in history has solved eight wars in a period of nine months.“ Anscheinend kannte auch das Nobelkomitee niemanden, der das vollbracht hatte.
Im eigenen Land sorgt sich Trump weniger um den Frieden. Er stachelt seine Anhänger*innen erfolgreich zu Hass und Hetze an, nicht erst seit dem Sturm aufs Kapitol. Mit Schaudern lässt sich beobachten, wie sich unter Trump der demokratische Verfassungsstaat langsam in einen Gottesstaat zu wandeln scheint: die Macht löst sich vom Recht ab, Kirche und Staat verschmelzen wieder. PAUL W. KAHN (EN) zeigt, warum die Ermordung von Charlie Kirk, der Aufstieg christlich-nationalistischer Bewegungen und die staatliche Gewaltbereitschaft gegenüber „enemies within“ einen entscheidenden Wendepunkt markieren.
In Deutschland ist man davon zum Glück weit entfernt. Hier muss man eher aufpassen, dass der Verfassungsgrundsatz staatlicher Neutralität nicht für etwas herhält, für das er nicht gedacht war. So in Berlin: Seit 2005 verbietet dort das „Neutralitätsgesetz“ pauschal das Tragen sichtbarer religiöser und weltanschaulicher Symbole und Kleidungstücke in Justiz, Polizei und Schulen – und widerspricht spätestens seit dem BVerfG-Urteil zu Kopftuchverboten von 2015 der Verfassung. Eine Gesetzesnovelle soll das nun ändern. Warum sie daran scheitert und das Neutralitätsgesetz lieber ganz abgeschafft werden sollte, zeigt SHINO IBOLD (DE).
Ein weiterer Berliner Gesetzesentwurf hat uns beschäftigt: Vor zwei Wochen stellte „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ ihre Ideen für ein Vergesellschaftungsgesetz vor. Die Initiative lädt nun dazu ein, Stellungnahmen abzugeben. GEORG FREISS (DE) untersucht den Entwurf und lobt: Die so geförderte offene Diskussion über die Wirtschafts- und Eigentumsordnung sei ganz im Sinne des Grundgesetzes und rufe die Öffentlichkeit – insbesondere die Rechtswissenschaft – zur aktiven Teilhabe auf.
Auch Konkurrenzparteien sind nun aufgerufen, aktiv zu werden – nämlich wenn es um Parteispenden geht. Zwar durfte die CDU 2020 eine umstrittene Parteispende i.H.v. 800.000 € annehmen, wie jetzt das VG Berlin entschied. Damit scheiterte „DIE PARTEI“, die die CDU wegen des Verstoßes gegen ein Spendenannahmeverbot sanktionieren lassen wollte. Allerdings hat das Gericht den Drittrechtsschutz im Parteienfinanzierungsrecht anerkannt und damit klargestellt, dass konkurrierende Parteien die Entscheidungen der Bundestagspräsidentin überprüfen lassen können – ein Gewinn für die Parteiendemokratie, findet HEIKE MERTEN (DE).
Weniger Glück als die CDU hatte Nikolas Sarkozy, der wegen illegaler Wahlkampfgelder aus Libyen zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Die Verurteilung hat alte Vorwürfe einer politisierten Justiz in der „République“ neu entfacht. Doch was bedeutet es eigentlich, republikanisch zu sein? THIBAULT CARRÈRE (EN) analysiert die Kritik am Urteil – und das besondere Verständnis von Republikanismus, das ihm zugrunde liegt.
Sarkozy hat jedenfalls Berufung eingelegt und darf danach mit einer einzigen bindenden Entscheidung rechnen: ne bis in idem. Dass dieser praktische Grundsatz nicht nur für französische Staatspräsidenten, sondern auch für Terrorist*innen gilt, hat nun der EuGH klargestellt: Spanien darf eine frühere Anführerin der ETA nicht erneut wegen terroristischer Taten anklagen. Für ne bis in idem zähle nicht die rechtliche Einordnung, sondern ob es sich um das gleiche tatsächliche Verhalten handelt. ANNE SCHNEIDER (EN) hält das Urteil für ein deutliches Zeichen: Auch bei grenzüberschreitendem Terrorismus stoße die Zusammenarbeit der Strafjustiz in Europa an rechtsstaatliche Grenzen.
Terrorismus stößt manchmal auch an räumliche Grenzen: Im Magdeburger Verfahren zum Weihnachtsmarkt-Anschlag sind viele Opfer beteiligt, sodass die bestehenden Gerichtssäle nicht ausreichen. Ein temporäres Gerichtsgebäude schafft nun Raum. Doch was bedeutet das für den Öffentlichkeitsgrundsatz und die Rolle der Nebenklage? MAX KLARMANN (DE) schreibt zur Balance zwischen Teilhabe und Verfahrensgerechtigkeit.
Manchmal schaffen Gerichte auch Räume für Verfassungsfeinde: Diesem Vorwurf sah sich das VG Stuttgart ausgesetzt, als es den pauschalen Ausschluss von AfD-Vorschlägen für die Wahl ehrenamtlicher Richter für unzulässig erklärte. Das Gericht habe der AfD damit den Weg zu ehrenamtlichen Richterstellen geebnet, so die Kritik. Warum nichts dran ist, erklärt ARNE PAUTSCH (DE).
++++++++++Anzeige++++++++++++

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d) im Projekt „Zugänglichkeit, Digitalisierung und Analyse historischer, europäischer Dissertationen [Dissify]“ gesucht!
Das Projekt befasst sich mit der Digitalisierung und rechtlichen Erfassung historischer, medizinischer Dissertationen. Kern des juristischen Projektteils ist die Erstellung eines Gutachtens zur umfassenden Nutzung dieser Dissertationen mit einem Fokus auf Urheberrecht und Datenschutzrecht. Ziel des Projekts ist es, diese Dissertationen nach Klärung urheber- und datenschutzrechtlicher Fragestellungen freizugeben und digital, auch im Kontext von KI und LLMs, für die wissenschaftliche Community nutzbar zu machen.
Weitere Informationen hier.
++++++++++++++++++++++++++++
In Großbritannien gibt es zwar, strictly speaking, keine Verfassung, aber zunehmend mehr Gegner*innen eines verfassungsähnlichen Dokuments: Forderungen nach einem Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention sind inzwischen Mainstream geworden, von Labour bis Tories, wie wir bei deren Parteitag diese Woche beobachten durften. ALICE DONALD (EN) warnt dringend vor dem Austritt.
Währenddessen bereitet sich Kamerun auf die Präsidentschaftswahlen diesen Sonntag vor. Der Verfassungsrat bestätigte nun, dass Oppositionsführer Kamto ausgeschlossen bleiben wird. LAURA-STELLA ENONCHONG (EN) kritisiert die formalistische Entscheidung des Rates und erklärt, was sie für Kameruns fragile Demokratie bedeutet.
Auch Bulgariens Demokratie zeigt sich fragil: Nachdem das Berufungsgericht in Sofia die Untersuchungshaft des Bürgermeisters von Warna, Blagomir Kotsev, bestätigt hatte, wollte der Oberste Justizrat die Sechsmonatsgrenze für Borislav Sarafovs Amtszeit als Generalstaatsanwalt aussetzen. Für BLAGA THAVARD (EN) ein Symptom dessen, was sie als Bulgariens „Krise der Legalität“ bezeichnet: Rechtsstaatlichkeit werde auf bloße Form reduziert und schütze keine Rechte mehr, sondern diene stattdessen dem Selbsterhalt und der Kontrolle staatlicher Institutionen.
In den USA zweifeln manche gerade am Selbsterhalt einer bestimmten Institution: Letzte Woche kam es zu einem teilweisen „government shutdown“, nachdem der Kongress die Finanzierung für das neue Haushaltsjahr nicht genehmigt hatte. Für ausländische (und auch viele inländische) Beobachter*innen mag dies verwirrend wirken. ZACHARY S. PRICE (EN) erklärt: Die Shutdowns seien zentrale Merkmale der Gewaltenteilung in den USA und in diesem Sinne eher ein Zeichen verfassungsrechtlicher Stärke als Schwäche – zugleich zeigten sie, wie akute parteipolitische Spaltungen die amerikanische Regierungsführung erschweren.
Erschwerte Regierungsführung durch Spaltung kennt die EU nur zu gut. Immer wieder scheitern Sanktionen an Ungarns Veto. Ein Shutdown nützt da wenig. Aber wie lässt sich die ungarische Blockade überwinden – vollständig im Geiste der Verträge, ohne auf juristische Fantasien zurückzugreifen? JOHANNES SCHÄFFER (EN) schlägt eine einfache und solide Lösung vor: Die Entscheidung des Rates auf das Minimum reduzieren und die Details der Sanktionen per qualifizierter Mehrheit festlegen.
Auch das Europäische Parlament und die Kommission überarbeiten ihre gegenseitige institutionelle Zusammenarbeit. Dazu gibt es seit 2005 ein Rahmenabkommen. ANDREW DUFF (EN) fasst die wichtigsten Änderungen zusammen und skizziert, wie sich das neue Abkommen auf die politischen und legislativen Prozesse der Union auswirken könnte.
Und endlich auch mal gute Neuigkeiten: Der Inter-Amerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat ein Menschenrecht auf Fürsorge anerkannt und die jeweiligen staatlichen Pflichten konkretisiert. MIRIAM L. HENRÍQUEZ VIÑAS und SABRINA RAGONE (EN) erklären, was das Recht vorsieht und von Staaten verlangt.
Doch bei rein zwischenmenschlicher Fürsorge wollen wir diese Woche nicht stehen bleiben und haben das „Defund Meat“ Symposium gestartet, das SASKIA STUCKI und ANNE PETERS herausgeben, unterstützt vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Was nach radikaler Rhetorik klingt, ist in Wirklichkeit die gesunde Vernunftidee, dass wir die öffentliche Unterstützung für eine Branche beenden sollten, die sich als äußerst schädlich erwiesen hat, erklärt SASKIA STUCKI (EN) in ihrer Einleitung. PAOLA CAVALIERI (EN) argumentiert, dass es neues radikales Denken braucht, um dem tierindustriellen Komplex zu begegnen. MARCO SPRINGMANN (EN) analysiert, welche Herausforderungen durch Ernährungsumstellungen entstehen, und schlägt einen umfassenden Lösungsansatz vor. KRISTEN STILT (EN) erläutert, wie die intensive Tierproduktion die öffentliche Gesundheit bedrohen kann. ODILE AMMANN (EN) demonstriert, wie Fleischlobbyist*innen Fakten verzerren und Normen beeinflussen. CLEO VERKUIJL (EN) skizziert fünf Lehren, die sich aus der Steuerung fossiler Brennstoffe für die Governance der industriellen Fleischproduktion ziehen lassen. ANNE PETERS (EN) argumentiert, dass – während die Landwirtschaft generell vor Handelsliberalisierung geschützt wird – ein solcher Protektionismus zum Wohle des Tierschutzes im Fleischhandel gestärkt werden sollte. Obwohl die globale Fleisch-Governance derzeit vor erheblichen politischen Hindernissen steht, erkennt ANDRÉ NOLLKAEMPER (EN) erste Anzeichen für Veränderungen, wie etwa die Ausweitung der „No-Harm“-Regel auf den Klimawandel.
Die „No-Harm“-Regel auszuweiten scheint uns nicht nur zur Feier der Friedensnobelpreisverleihung eine noble Idee, vielleicht sogar nobler als der Preis selbst. Immerhin ist es mit dem Frieden wie mit der Freiheit – er ist kein Zustand, der sich erreichen lässt, sondern eine Praxis, die wir jeden Tag leben müssen.
*
Das war’s für diese Woche.
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.



