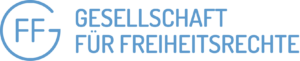„Nur die wachsame Demokratie kann eine wehrhafte Demokratie sein“
Fünf Fragen an Kyrill-Alexander Schwarz
Seit 2021 führte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die AfD als Verdachtsfall – nun hat das BfV die Partei als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft. Die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will zeitnah im Kabinett darüber beraten, wie jetzt mit der AfD umzugehen ist. Wir haben mit Kyrill-Alexander Schwarz darüber gesprochen, was aus der Einstufung folgt. Er ist Professor für Öffentliches Recht am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Würzburg und hat letztes Jahr eine rechtswissenschaftliche Stellungnahme zum AfD-Parteiverbot mitverfasst.
1. Das BfV hat die AfD zwar als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft, verweigert jedoch die Freigabe des 1108-seitigen Gutachtens. Am Mittwoch veröffentlichte FragDenStaat einen 17-seitigen Auszug und der Spiegel eine Auswertung des Gutachtens. Welche legitimen Gründe können die weitere Geheimhaltung rechtfertigen?
Jenseits der Frage eines möglicherweise notwendigen Quellenschutzes kann es in einem transparenten Rechtsstaat keinen tragenden Grund geben, das Gutachten nicht zu publizieren. Wenn eine Partei mit dem Vorwurf verfassungsfeindlicher Tendenzen konfrontiert wird, muss die Öffentlichkeit wissen, warum hier ein massiver Eingriff in die Mitwirkung an der politischen Willensbildung erfolgt – gerade um die öffentliche Kontrolle zu gewährleisten, auch in einem möglichen gerichtlichen Verfahren. Nur die wachsame Demokratie kann eine wehrhafte Demokratie sein. Dabei ist es für die Öffentlichkeit auch von Interesse zu erfahren, warum die Veröffentlichung gerade jetzt erfolgte. Geschah dies auf Weisung oder vielleicht ohne Wissen der ehemaligen Bundesinnenministerin? Wie selbständig kann das BfV – immerhin eine nachgeordnete und weisungsgebundene Behörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums – hier agieren? All das sind Fragen, an deren Beantwortung ein legitimes Interesse besteht, um die Fairness der Auseinandersetzung im politischen Prozess auch mit Extremisten zu garantieren und damit von Anfang an zu verhindern, dass die AfD wieder politische Narrative einer gezielten Benachteiligung durch das „System“ bedient, um so ihre Opferrolle zu pflegen.
2. Seit der Einstufung wird vor allem diskutiert, ob nun ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD eingeleitet werden muss. Laut Gesetz „können“ Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung den Antrag dazu stellen, das BVerfG spricht sowohl von „pflichtgemäßem“ als auch von „politischem“ Ermessen. Wie kann die Einstufung durch das BfV dieses Ermessen rechtlich beeinflussen?
Die Einstufung durch das BfV löst keinen Automatismus aus; es handelt sich um eine neue Einschätzung auf der Grundlage eines gesetzlichen Auftrags, die eine entsprechende Realanalyse voraussetzt. In der Bewertung entscheidet das BfV dann über das Ausmaß an Verfassungsfeindlichkeit und das damit verbundene Gefahrenpotential für den freiheitlichen Verfassungsstaat, das die Einstufung rechtfertigen kann. All das ändert nichts daran, dass die möglichen Antragsteller im Parteiverbotsverfahren (also Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat) auf dieser Grundlage eine eigene Entscheidung treffen können, bei der neben einer Analyse des tatsächlichen Materials und der rechtlichen Bewertung auch politische Fragen einfließen können. Allerdings dürfte, wenn man das Konzept einer wehrhaften Demokratie ernst nehmen möchte, mit zunehmender Verdichtung des Charakters als verfassungsfeindliche Organisation der eigene Entscheidungsspielraum abnehmen und eher von einer Pflicht zur Antragstellung auszugehen sein, die zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung besteht. Diese Pflicht ist allerdings nicht prozessual durchsetzbar, sondern eher eine Frage politischer Verantwortlichkeit. Dessen ungeachtet muss sich aber das Bundesverfassungsgericht, das hier auch Tatsacheninstanz ist, ein eigenes Bild davon machen, ob die Verbotsvoraussetzungen vorliegen und damit die hohen Hürden auch erfüllt sind.
++++++++++Anzeige++++++++++++

ALLE REDEN DRÜBER – WIR WOLLEN ES WISSEN!
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hält die AfD für gesichert rechtsextremistisch. Aber ist sie verfassungswidrig? Die Gesellschaft für Freiheitsrechte klärt das in einem umfassenden wissenschaftlichen Gutachten und sucht dafür erfahrene Jurist*innen.
Mehr dazu unter: https://freiheitsrechte.org/jobs
++++++++++++++++++++++++++++
3. Das Grundgesetz ermöglicht auch den Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung. Dafür gelten nach Art. 21 Abs. 3 GG ähnliche Anforderungen wie für das Verbot selbst. Aber wie steht es um die Finanzierung der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung? Wie kann sich die Einstufung darauf auswirken und welche Rolle spielt dabei das Gleichbehandlungsgebot?
Zunächst ist festzuhalten, dass – anders als dies im politischen Raum bisweilen verbreitet wird – der Ausschluss von der staatlichen Finanzierung weitgehend identische Voraussetzungen wie ein Parteiverbotsverfahren hat; nur hinsichtlich der Notwendigkeit eines aggressiv kämpferischen Verhaltens ist das Parteiverbot noch strenger. Insoweit dürfte der Verweis auf den Entzug finanzieller Mittel anstelle eines Parteiverbots – bei aller Sympathie für den Entzug staatlicher Mittel für Verfassungsfeinde – an den klaren normativen Vorgaben des Grundgesetzes vorbeigehen.
Die Frage der Stiftungsfinanzierung ist insoweit eine andere, als die Stiftungsfinanzierung ein positives Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung materiell voraussetzt. Dies entspricht insoweit der beamtenrechtlichen Treuepflicht oder den Anforderungen an das Gemeinnützigkeitsrecht. Hier zeigt der demokratische Verfassungsstaat, dass er im Bereich der wichtigen und notwendigen Arbeit politischer Stiftungen mehr verlangt als eine bloße Indifferenz gegenüber dem Staat: Er will ein aktives Eintreten als Loyalitätsbekundung und darf dies auch fordern, weil für politische Stiftungen das Parteienprivileg des Grundgesetzes gerade nicht gilt. Politische Stiftungen sind zwar parteinah, aber keine Partei; die Schutzwirkungen des Grundgesetzes für Parteien greifen also nicht. Ein Gleichheitsverstoß ist nicht ersichtlich, wenn Behörden zu der Einschätzung gelangen, die der AfD nahestehende Desiderius-Erasmus-Stiftung erfülle diese Voraussetzungen nicht, weil beispielsweise die sie prägende politische Grundströmung ihrerseits verfassungsfeindlich geprägt ist.
4. Als Beamt*innen sind AfD-Mitglieder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zur Treue verpflichtet – einer Ordnung, die mit dem in ihrer Partei „vorherrschende[n] ethnisch-abstammungsmäßige[n] Volksverständnis“ laut BfV nicht vereinbar ist. Was wird nun aus all jenen AfD-Mitgliedern, die besondere staatliche Verantwortung tragen – etwa an Gerichten, bei der Polizei oder in der Schule?
Auch hier gilt, dass das Gutachten des BfV selbst zunächst keine unmittelbaren Rechtswirkungen entfaltet. Es bedarf auch weiterhin in jedem Fall einer Einzelfallprüfung, ob bei einem Amtsträger die Voraussetzungen für disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Entfernung aus dem öffentlichen Dienst vorliegen. An die bloße Mitgliedschaft in einer extremistischen Partei anzuknüpfen, wäre eine Verletzung des Parteienprivilegs, solange und soweit die Partei noch nicht verboten ist. Das hindert aber nicht, Führungsmitglieder der Partei, die sich nicht von entsprechenden Aussagen hinreichend distanzieren, oder auch andere Parteimitglieder, die in sozialen Netzwerken entsprechend extremistische Inhalte teilen und weiterverbreiten, wegen dieses Verhaltens im Einzelfall juristisch zu belangen. Hier zeigt sich im Übrigen, dass das Verwaltungsrecht – jenseits des zweischneidigen Schwerts des Parteiverbots – auch hinreichende Reaktionsmöglichkeiten vorhält, mit Extremisten im öffentlichen Dienst umgehen zu können.
++++++++++Anzeige++++++++++++
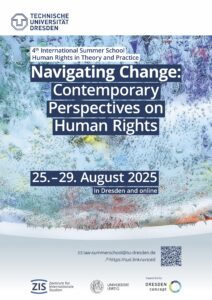 Human Rights in Transition? Register Now for the International Summer School in Dresden
Human Rights in Transition? Register Now for the International Summer School in Dresden
The 4th International Summer School “Human Rights in Theory and Practice” will take place from August 25 to 29, 2025 at TU Dresden and online. Under the theme “Navigating Change – Contemporary Perspectives on Human Rights,” current challenges such as climate change, health risks, and AI will be discussed from a human rights perspective. Participants can expect expert-led sessions, interactive formats including a practice-oriented final conference, and a rich social program.
Provisional registration deadline: June 30, 2025.
Further information: here.
++++++++++++++++++++++++++++
5. Inzwischen geht die AfD gegen ihre Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch“ gerichtlich vor. Wovon hängen die Erfolgsaussichten ab und was könnte das Verfahren bedeuten?
Es steht der AfD – wie jedem anderen Betroffenen – frei, sich gegen aus ihrer Sicht rechtswidrige hoheitliche Maßnahmen gerichtlich zur Wehr zu setzen; ob ihre Einschätzungen zutreffend sind, entscheiden in einem gewaltenteilenden Verfassungsstaat die dafür zuständigen Gerichte nach Maßgabe des geltenden Rechts. Zu den Erfolgsaussichten möchte ich mich in Ansehung des bisher nicht vollständig bekannten Inhalts des Gutachtens des BfV nicht äußern – das wäre bloße Spekulation.
Umgekehrt ist aber auch die jetzt vorliegende Stillhaltezusage des BfV – also die Selbstverpflichtung, die AfD bis zum Abschluss des gerichtlichen Verfahrens nicht weiter als gesichert rechtsextrem zu bezeichnen und auch den entsprechenden Hinweis von der Homepage zu entfernen – eine verwaltungsprozessual anerkannte Vorgehensweise, die der Entlastung der Gerichte dient und nichts über die Erfolgsaussichten sagt. Schon als es um die Einstufung als Verdachtsfall ging, ist das BfV – auch aus Respekt gegenüber der Justiz – so vorgegangen und hat damals dennoch sowohl vor dem VG Köln als auch vor dem OVG Münster in der Hauptsache einen Erfolg erzielt. Insoweit erleben wir gerade die rechtsstaatliche Normalität, dass hoheitliches Handeln einer verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt – das ist die alltägliche Bewährung des Rechtsstaates und keine Besonderheit.
*
Editor’s Pick
von MAXIMILIAN STEINBEIS
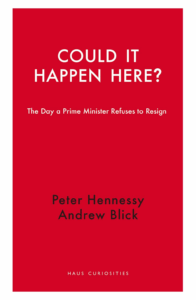
Could it Happen Here? Sieben Jahre ist es her, dass Cass Sunstein die bange Frage für sein Land, die USA, bejaht hat. „Full-blown authoritarianism“ erschien dem Harvard-Juristen 2018 in der ältesten Demokratie der Welt zwar unwahrscheinlich, aber definitiv möglich. 2025 sieht es so aus, als sei er real.
Was passiert, wenn „es“ passiert, ist eine Frage, die in vielen Demokratien mit wachsender Dringlichkeit gestellt wird, nicht zuletzt auch vom Verfassungsblog. Aber was genau ist „es“? Die Antworten weichen auf interessante Weise voneinander ab: Dass die Regierung aufhört, den Gerichten zu gehorchen, wäre die deutsche. Dass der Präsident seine exekutive Macht zum Sprengen aller institutionellen Fesseln einsetzt, wäre die amerikanische. Die britische: dass der Premierminister, obwohl er im Parlament keine Mehrheit hat, sich weigert zurückzutreten. Zu diesem Szenario haben zwei Historiker jetzt ein schmales, sehr empfehlenswertes Büchlein veröffentlicht. Einer davon, Peter Hennessy, ist der Schöpfer der berühmten „good chap theory of government“: Die britische Verfassung ruhe, anders als jede andere, nicht auf Normen und Verfahren und Institutionen, sondern auf dem Vertrauen, dass die an der Macht doch am Ende immer irgendwie wissen, was sich gehört. Dieses Vertrauen hat seit dem Brexit-Referendum 2014 massiv gelitten, und als „good chap“ würden den grinsenden Nigel Farage wohl nicht einmal dessen Fans bezeichnen wollen. Also höchste Zeit für Szenarienbildung, und eine Menge faszinierender Dinge über das Innenleben der britischen Verfassung zu lernen gibt es in diesem Buch obendrein.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER
Gestern war in Berlin Feiertag, um 80 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zu gedenken. Auch ohne Feiertag gibt es derzeit genügend Anlass, über die nationalsozialistische Gewaltherrschaft nachzudenken. Viele suchen deshalb bei den Zeitgenossen nach Antworten. Vor allem Carl Schmitt wird bemüht, um zu verstehen, was gerade in den USA passiert. Andere lesen Ernst Frankel, den sozialistischen Juristen und Kritiker Schmitts. Dessen Theorie vom „Doppelstaat“, in dem ein rechtsstaatlicher Normenstaat und ein willkürlicher Maßnahmenstaat nebeneinander existieren, scheint ziemlich genau Trump 2.0 zu beschreiben. Doch WILLIAM E. SCHEUERMAN (EN) ist skeptisch, ob Fraenkels Prämissen zutreffen.
Am 8. Mai gab außerdem das Bundesamt für Verfassungsschutz vor dem VG Köln gegenüber der AfD eine Stillhaltezusage ab: Die Pressemitteilung, mit der das BfV die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ letzten Freitag bekannt gab, ist nicht mehr abrufbar. Die Debatte (die wir mit KYRILL-ALEXANDER SCHWARZ oben besprochen haben) ist damit natürlich nicht aus der Welt. Dabei werde oft nicht zwischen den rechtlichen Anforderungen für die Einstufung einerseits und für das Parteierbot andererseits unterschieden, beobachtet FOROUD SHIRVANI (DE), und erklärt, was das eine für das andere bedeuten kann (und was nicht).
THEO RUST (DE) wirft ein, dass beim Parteiverbot nicht nur nationales Recht relevant wird: Es ist damit zu rechnen, dass die AfD nach einem Verbot ein Beschwerdeverfahren nach Art. 34 EMRK einleiten wird, dieses also den menschenrechtlichen Vorgaben entsprechen muss – eine Eventualität, die es schon jetzt mitzudenken gilt.
Dem 8. Mai wurde auch eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag gewidmet – ein Beispiel für Symbolik im Hohen Haus. Ein anderes, umstritteneres Beispiel: die Kufiya, die eine Linken-Abgeordnete bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags kürzlich trug. Was sagt eigentlich das Grundgesetz dazu, wie mit Symbolen im Plenarsaal umzugehen ist? Nicht viel, stellen ADIL DEMIRKOL und BENJAMIN RASIDOVIC (DE) fest, und fordern eine grundlegende Auseinandersetzung mit der juristischen Methodik der Symboldeutung.
Unsicherheiten gibt es nicht nur bei der Symboldeutung, sondern auch bei politischen Konzepten im Recht: Der neue Art. 143h GG berechtigt nun zwar den Bund unter anderem dazu, ein Sondervermögen „für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045” einzurichten – doch handelt es sich bei „Klimaneutralität“ um ein klimapolitisches Konzept, das Gerichte und Gesetzgeber ganz unterschiedlich anwenden. OLIVER GEDEN und ALEXANDER PROELSS (DE) nehmen das zum Anlass, um über das Verhältnis von Klimawissenschaft und Klimapolitik im Recht nachzudenken.
Der 8. Mai ist auch ein Anlass, um über Migration und Staatsbürgerschaft nachzudenken. In diesem Kontext sorgt das EuGH-Urteil Kommission gegen Malta derzeit für viel Aufsehen: Allein diese Woche haben wir dazu fünf Beiträge auf dem Blog veröffentlicht – ein spontanes Mini-Symposium. In dem Urteil entschied die Große Kammer, dass Maltas sogenanntes „Golden Passport“-Programm – die Vergabe der Staatsbürgerschaft gegen Investitionen – gegen EU-Recht verstößt. Der EuGH betonte, dass die Unionsbürgerschaft auf dem Prinzip des gegenseitigen Vertrauens beruht.
MARTIJN VAN DEN BRINK (EN) kritisiert, dass das Urteil keine überzeugende rechtliche Begründung für diese Ausweitung des EU-Bürgerschaftsbegriffs liefere – und warnt vor den Gefahren eines zu dünn begründeten Grundsatzurteils. LUKE DIMITRIOS SPIEKER (EN) hält dagegen: Es sei nicht unbedingt eine schlechte, sondern vor allem eine schwierige Entscheidung, und ohnehin hätten viele der im Nachhinein großen Urteile des EuGH ähnliche Unschärfen hinterlassen.
Der EuGH bezeichnet in seinem Urteil die EU-Bürgerschaft als „Ausdruck der Solidarität und des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten“. Für RUAIRI O’NEILL (EN) zeigt das: Gegenseitiges Vertrauen ist nicht nur ein Prinzip, sondern hat Verfassungsrang – und kann gegen nationale Verwaltungspraktiken, die mit den Werten des Artikels 2 EUV kollidieren, wirksam eingesetzt werden. ANJA BOSSOW (EN) analysiert die Gefahren und Potenziale dieses anspruchsvolleren Konzepts von Staatsbürgerschaft: Der bloße rechtliche Status reicht dabei nicht – es braucht auch eine persönliche Verbindung zwischen Person und Staat. DIMITRY VLADIMIROVICH KOCHENOV (EN) warnt davor, außerrechtliche Kriterien in die Unionsbürgerschaft einzuschleusen – und sieht die Gefahr einer illiberalen Wendung.
In Luxemburg steht eine weitere wichtige Entscheidung an: In den verbundenen Fällen Alace und Canpelli geht es die Frage, ob und wie EU-Mitgliedstaaten definieren dürfen, welche Länder als „sichere Herkunfts- oder Drittstaaten“ gelten. Diese Einstufung ist zentral für das umstrittene Italien-Albanien-Abkommen, das Asylverfahren für Menschen aus als „sicher“ geltenden Ländern auslagert. Aber wie sicher ist sicher genug? Generalanwalt de la Tour schlägt in seinem Gutachten vor: „Im Allgemeinen sicher“ reicht – auch wenn bestimmte Gruppen weiterhin gefährdet sind. MATILDE ROCCA (EN) warnt: Dieses Verständnis könnte die Menschenrechte gefährden.
Auch innerhalb der EU drohen menschenrechtliche Schutzlücken: Die Kommission will sich vom Entwurf einer KI-Haftungsrichtlinie zurückziehen. Ziel des Entwurfs war es, Betroffene von KI-bedingtem Schaden besser vor Gericht zu schützen. CRISTINA FRATTONE (EN) zeigt: Trotz Schwächen wäre die Richtlinie zum Schutz von Opfern algorithmischer Systeme wichtig gewesen.
Diese Woche haben wir das Symposium zu „Ongoing Controversies over Methods in EU Law – Towards a Reflexive Turn“ (EN). VINCENT RÉVEILLÈRE zeigt im ersten Beitrag, wie methodische Debatten im EU-Recht – seit dem Symposium “Controversies over Methods in EU Law” aus dem letzten Jahr – stark von den Krisen in und um Europa geprägt sind. PÄIVI JOHANNA NEUVONEN beobachtet: Das zunehmende Interesse an „Kritik“ als Methode birgt die Gefahr, dass der Begriff selbst verwässert wird. LAURE CLÉMENT-WILZ macht den „menschlichen Faktor“ zum Ausgangspunkt rechtswissenschaftlicher Analyse. Und JENNIFER ORLANDO-SALLING zeigt wie dekoloniale Ansätze Brücken zwischen Theorie, Geschichte und Praxis schlagen können.
Gedenktage wie der 8. Mai sind genau dafür da: Sie erinnern daran, wie Geschichte, Theorie und Praxis miteinander verbunden sind. Was ist geschehen? Warum? Und was folgt daraus – für uns, hier und heute? Im Deutschen verdichten sich diese Fragen zu einem einzigen Wort: „Vergangenheitsbewältigung“ – ein nie abgeschlossener Prozess, der sich, wie Autor Max Czollek beschreibt, nicht auf die Vergangenheit beschränkt: Auch „Gegenwartsbewältigung“ ist unsere Verantwortung. Dass der Verfassungsblog Raum für beides bietet – dafür danken wir unseren Autor*innen. Und Ihnen.
*
Ihnen alles Gute!
Ihr
Verfassungsblog-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.