Leerstelle Ostdeutschland
Das Grundgesetz und Ostdeutschlands fehlende Spuren
Anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums lässt sich konstatieren: Das Grundgesetz ist eine gute Verfassung – mit seinem ausgeprägten Grundrechtsschutz und den in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätzen schützt es auch die Interessen jener, die nicht an den Schalthebeln der Macht sitzen. Stolz sind wir darauf, dass es Lehren aus der deutschen Geschichte abbildet. Die Unterstützung in der Bevölkerung ist entsprechend groß. Aber Spuren der ostdeutschen Geschichte finden sich in der Verfassung nicht.
Das wollte 1990 ein Großteil der ostdeutschen Bevölkerung auch so. Die Einheit sollte möglichst schnell als Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Art. 23 GG (alt) erfolgen. Die frei gewählte Volkskammer befasste sich nicht mehr mit dem Verfassungsentwurf des Zentralen Runden Tischs der DDR. Sie nahm in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1990 mit überwältigender Mehrheit den Antrag der Fraktionen der CDU/DA, DSU, FDP und SPD für den Beitritt an. Weit über 80 % der Ostdeutschen fanden diesen Weg richtig. Zwar gab es in der DDR-Bürgerrechtsbewegung, in der SPD und bei den Grünen Stimmen für eine neue gesamtdeutsche Verfassung, aber die meisten waren der Meinung: Das Grundgesetz hat sich bewährt, eine neue Verfassung ist nicht nötig. Daher wurden Diskussionen, die für das Verständnis des historischen Vorgangs und die Bedeutung des Grundgesetzes wichtig gewesen wären, nicht in der notwendigen Breite geführt, sondern nur in einschlägigen intellektuellen und politischen Kreisen.
Die Änderungen infolge des Einigungsvertrags waren minimal. So wurde in der Präambel (ebenso wie in Art. 146 GG) festgestellt, dass die deutsche Einheit vollendet sei und der provisorische Charakter des Grundgesetzes gestrichen. Der alte Art. 23 GG war nun ebenfalls entbehrlich. Bundesländer mit mehr als sieben Millionen Einwohnern erhielten sechs Stimmen im Bundesrat, womit die Sperrminorität der großen Länder bei Verfassungsänderungen gesichert blieb. Und in den neuen Ländern durften Gesetze bis spätestens Ende 1992 bzw. bestimmte Gesetze bis 1995 unter bestimmten Bedingungen vom Grundgesetz abweichen.
Eine im Zuge der Beitrittsverhandlungen vereinbarte Gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundesrat sollte über mögliche weitere Änderungen des Grundgesetzes beraten. 1994 wurden dann unter anderem die Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau durch den Staat, das Diskriminierungsverbot für Menschen mit Behinderungen (beides Art. 3 GG), das Staatsziel Umweltschutz (Art. 20a GG), die Möglichkeit des Bundes, im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung tätig zu werden, wenn das Ziel die „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ ist (Art. 72 GG; vorher hieß es: „die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“), sowie eine Abweichung von der allgemeinen Regelung für Länderneugliederungen für die angestrebte Fusion von Berlin und Brandenburg (Art. 29, 118a GG) festgeschrieben.
Diese und weitere Änderungen können kaum als Lehren aus dem Bestehen des zweiten deutschen Staates oder Impulse aus der friedlichen Revolution betrachtet werden, auch wenn der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bürgerrechtsbewegung in der DDR aufgrund der Umweltverschmutzung in Teilen der DDR ein wichtiges Anliegen gewesen war. Und ja, es gab Einheitsbezüge, etwa bei der Herunterstufung der Wahrung der einheitlichen auf gleichwertige Lebensverhältnisse als Grund für ein Tätigwerden des Bundes im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung. Diese Änderungen trugen den unterschiedlichen sozioökonomischen Rahmenbedingungen Rechnung, waren aber keine Lehre aus der Geschichte.
++++++++++Anzeige++++++++

Die Stiftung Umweltenergierecht ist eine rechtswissenschaftliche Forschungseinrichtung, die rund um die Frage forscht: Wie muss sich der Rechtsrahmen ändern, damit wir in Deutschland und Europa unsere Klimaziele erreichen können?
Wir suchen Projektleitungen in den folgenden Forschungsgebieten:
Europäisches und internationales Energie- und Klimaschutzrecht
Recht der erneuerbaren Energien und Stromversorgung
Planungs- und Genehmigungsrecht
Weitere Informationen finden Sie unter https://stiftung-umweltenergierecht.de/karriere/
++++++++++++++++++++++++
Dass sich die Erfahrungen der Ostdeutschen nicht im Grundgesetz niederschlugen, fällt umso mehr auf, wenn man berücksichtigt, dass in der Zeit wichtige andere Verfassungsänderungen beschlossen wurden, etwa die Einfügung des Europaartikels, die Asylrechtsreform sowie die Privatisierung der Bundeseisenbahnen und Bundespost.
Die vielleicht wichtigste Grundgesetzänderung infolge des Einigungsvertrags erfolgte aber erst 2006: In Art. 22 GG wurde ergänzt, dass Berlin die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist. Aber auch hier ging es zu diesem Zeitpunkt gar nicht (mehr) um die deutsche Einheit, sondern Hintergrund war der Wunsch, das finanzklamme Land Berlin durch Sonderzuweisungen des Bundes für die Erfüllung der Hauptstadtfunktion zu unterstützen. In den 1990er Jahren war die Hauptstadtfrage hingegen ein heißes Eisen gewesen; gegen den Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin gab es viel politischen Widerstand.
Welche Spuren der ostdeutschen Geschichte hätten im Grundgesetz Niederschlag finden können? Das lässt sich in Brandenburg besichtigen, wo das Recht auf Achtung der Würde des Menschen im Sterben und das Verbot wissenschaftlicher Versuche am Menschen (beides Art. 8) sowie die Anerkennung der Schutzbedürftigkeit nichtehelicher Lebensgemeinschaften (Art. 26) in die Landesverfassung aufgenommen wurden. Es wurden direktdemokratische Instrumente auf Landes- und kommunaler Ebene eingeführt. Anerkannte Umweltverbände erhielten das Recht auf Beteiligung an Verwaltungsverfahren, die die natürlichen Lebensgrundlagen betreffen, und das Land wurde dazu verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass auf dem Landesgebiet keine ABC-Waffen entwickelt, hergestellt oder gelagert werden (beides Art. 39 [9]). Das Land wurde außerdem verpflichtet, eine breite Streuung des Eigentums, insbesondere die Vermögensbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch Beteiligung am Produktiveigentum zu fördern (Art. 41) sowie im Rahmen seiner Kräfte durch eine Politik der Vollbeschäftigung und Arbeitsförderung für die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit zu sorgen (Art. 48). Zudem sollte es verpflichtet werden, auf die Abschaffung des § 218 hinzuwirken, in dem ein Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt war – ein Passus, der später gestrichen wurde, um der CDU entgegenzukommen.
Natürlich trugen diese Inhalte eine weltanschauliche Handschrift. Die SPD-geführte Landesregierung hatte 1991/92 ein Interesse daran, der konservativ-liberalen Mehrheit im Bundestag etwas entgegenzusetzen. Aber auch die unter einer CDU-Alleinregierung verhandelte Landesverfassung Sachsens enthält Inhalte, die als Spuren ostdeutscher Geschichte verstanden wurden: Das Land erkennt das Recht eines jeden Menschen auf ein menschenwürdiges Dasein, insbesondere auf Arbeit, auf angemessenen Wohnraum, auf angemessenen Lebensunterhalt, auf soziale Sicherung und auf Bildung, als Staatsziel an (Art. 7), fördert den vorbeugenden Gesundheitsschutz für Kinder und Jugendliche sowie Einrichtungen zu ihrer Betreuung (Art. 9), definiert den Schutz der Umwelt als Pflicht des Landes und Verpflichtung aller im Land (Art. 10), regelt Grundsätze für den Fall einer Freiheitsentziehung, bindet Förderung (und Entlastung) von Familien nicht an die Ehe und erweitert sie auf die Betreuung von Hilfsbedürftigen, d.h. nicht nur von Kindern (Art. 22). Dies drücke „das Streben nach Gerechtigkeit, nach friedlichem Zusammenleben der Menschen und nach dem Erhalt einer lebenswerten Umwelt“ aus, so Landtagspräsident Rösler. Die ostdeutschen Landesverfassungen bildeten in verschiedenen Varianten den Willen zum sozialen Ausgleich in der Verfassung ab und die Verankerung direktdemokratischer Instrumente wurde als Verpflichtung gegenüber der friedlichen Revolution von 1989 empfunden. Im Kontrast dazu wird das Grundgesetz trotz des verankerten Sozialstaatsprinzips von vielen nicht als soziale Verfassung wahrgenommen und auch nicht als eine, die den Menschen unmittelbare Mitsprache ermöglicht.
++++++++++Anzeige++++++++

The Professorship of European Law
The Board of Electors to the Professorship of European Law invite applications for this Professorship from persons whose work falls within the general field of the title of the office to take up appointment on 1 January 2025 or as soon as possible thereafter.
Applications should be made online by 12 June Professorship of European Law – Job Opportunities – University of Cambridge
Informal enquiries may be directed to Professor Mark Elliott (convenor of Board of Electors): mce1000@cam.ac.uk.
++++++++++++++++++++++++
Ostdeutsche Politiker betonen häufig, dass die Landesverfassungen gerade auch wegen der Bezüge zur eigenen Geschichte eine große identitätsstiftende Kraft haben. Diese Kraft hat das Grundgesetz nicht, denn Ostdeutsche sehen darin kaum Spuren ihres eigenen Tuns und ihrer Geschichte. Sie übernahmen es 1990 freiwillig und unterstützen es weit überwiegend, aber die Zustimmung basiert auf der Akzeptanz seiner Funktionalität, weniger auf Emotionen. Zudem geht selbst Zustimmung mit teils unterschiedlichen Vorstellungen davon einher, was die Bestimmungen bedeuten und was Demokratie ausmacht. Ostdeutsche sind häufiger der Ansicht, dass das Gleichheitsversprechen des Grundgesetzes nicht umgesetzt wird (was sich etwa an ihrer Unterrepräsentation in nahezu allen Sektoren festmachen lasse) und dass Parteien einen viel größeren Einfluss haben, als das Grundgesetz suggeriert. Viele wünschen sich Möglichkeiten einer direkten Einflussnahme auf die Bundespolitik, ergänzend zu Wahlen von Vertretungsorganen und zur Mitwirkung in Parteien.
Das Grundgesetz ist eine gute Verfassung, aber auch nach dem Jubiläum gibt es viel Stoff für ein gesamtdeutsches Nachdenken über seine Leitideen und Inhalte, Geschichte und Praxis.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
Das Grundgesetz hat diese Woche sein 75. Jubiläum. Aber was feiern wir da eigentlich, wenn wir das Grundgesetz feiern? CHRISTOPH MÖLLERS meint: Auf einem „gemeinsamen Wertefundament“ fußt das Grundgesetz jedenfalls nicht. Vielmehr sei das Grundgesetz von Politikerinnen und Politikern geschaffen worden, um Politik zu ermöglichen. Wenn man die „Werte” des Grundgesetzes erhalten wolle, müsse man vor allem die demokratische Politikfähigkeit der Gesellschaft schützen.
Am 20. Mai 2024 hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) bekannt gegeben, dass er in der „Situation Palästina“ mehrere Haftbefehle gegen Mitglieder der Hamas und der israelischen Regierung beantragt hat. Worum es in den Anträgen geht, warum sie politische Sprengkraft haben und wie es jetzt weitergeht, zeigt STEFANIE BOCK.
Auch in Deutschland nehmen Studierendenproteste gegen den Gaza-Krieg zu. Wie in den Vereinigten Staaten errichten Studierende dabei häufig Protestcamps, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. In einigen Städten wurden entsprechende Protestcamps rasch geräumt, in anderen Städten reagierten die Behörden dagegen zunächst mit Auflagen. Wie das Vorgehen der Behörden versammlungsrechtlich zu bewerten ist und ob auch Hochschulen selbst gegen Proteste einschreiten können, erläutert NOAH ZIMMERMANN.
Die Polizeifestigkeit der Versammlung, also die Sperrwirkung der Versammlungsgesetze gegenüber dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht, gehörte bislang zu den Grundpfeilern des deutschen Versammlungsrechts. Danach muss die zuständige Behörde eine Versammlung zunächst auflösen, bevor sie weitergehende Maßnahmen ergreifen darf. BENJAMIN RUSTEBERG zeigt, wie sich das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil über „Verhinderungsblockaden“ in zweifelhafter Art und Weise über diese Schrittfolge hinwegsetzt.
Das Bundesverfassungsgericht hat letzte Woche entschieden, dass das Amt des Polizeipräsidenten in Nordrhein-Westfalen kein politisches sein sollte. TRISTAN WIßGOTT stellt methodische Rückfragen an die Entscheidung und kritisiert die “seit längerem betriebene Entparlamentarisierung des wiederentdeckten pouvoir neutre”. Darauf antwortet ARMIN STEINBACH und verteidigt die Entscheidung des Zweiten Senats gegen die Kritik. Amtscourage sei das Leitbild des Personals der Republik, nicht politische Konformität.”
Dass der französische Rassemblement National mit der AfD bricht, die nun auch aus der ID-Fraktion im Europaparlament ausgeschlossen wurde, erscheint wenig überraschend im Lichte von LÉONIE DE JONGEs Analyse über Rechtsaußen-Parteien in Europa. Sie zeigt, dass trotz ideologischer Gemeinsamkeiten viele Unterschiede die Zusammenarbeit erschweren.
Wie resilient ist die Beamtenschaft im Fall, dass Funktionäre einer autoritär-populistischen Partei in höchste Verwaltungspositionen gelangen? Beamt:innen trifft einerseits eine Folgepflicht, tragen andererseits aber die volle rechtliche Verantwortung für ihr dienstliches Handeln – und können so in unangenehme Konfliktsituationen kommen, wie ANDREAS NITSCHKE in einem Beitrag für das Thüringen-Projekt skizziert.
++++++++++Anzeige++++++++

The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law invites doctoral and postdoctoral researchers to apply as ‘engaged listeners’ for the Defund Meat Conference, taking place from 15-17 January 2025 in Heidelberg.
Engaged listeners are expected to participate actively in the discussions. Please apply via our online application system with a CV and letter of motivation (max. 500 words) by 15 July 2024. For more information, please visit the conference website.
++++++++++++++++++++++++
Am 16. Mai haben vier niederländische Parteien ein neues Regierungsabkommen vorgelegt. Die vier Parteien PVV, VVD, NSC und BBB werden eine der am weitesten rechts stehenden Regierungen in der Geschichte der Niederlande bilden. Im Rahmen des Abkommens schlagen sie Migrationsmaßnahmen vor, die die Grundrechte von Migranten und Personen, die internationalen Schutz beantragen, gefährden würden. ARON BOSMAN erklärt, warum dieser Plan die Niederlande auf Kollisionskurs mit der EU bringen würde, da viele Maßnahmen im Widerspruch zu den Bestimmungen des EU-Migrationspakts stehen, der letzte Woche verabschiedet wurde.
Nach Jahren, in denen die polnische Verfassung durch unvorstellbare rechtliche und faktische Handlungen und hasserfüllte Worte in Stücke gerissen wurde, sind der Wiederaufbau und die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit eine schwierige Aufgabe. TOMASZ TADEUSZ KONCEWICZ gibt Anhaltspunkte, wie man dabei vorgehen kann. Als erstes muss man den Ausgangspunkt der Route bestimmen. Als zweites muss der Weg von der Treue zur Verfassung bestimmt sein. Und schließlich muss das erklärte Ziel klar als Wiederherstellung der Bedeutung und der Achtung der Grundelemente der polnischen Rechtsordnung formuliert werden. Er argumentiert, dass letzteres zum neuen Narrativ von Jurist:innen, Politiker:innen und Bürger:innen gleichermaßen werden muss, wenn wir erfolgreich sein wollen.
Anfang diesen Monats hat Italien seine Liste der sicheren Herkunftsländer aktualisiert, in der Nigeria weiterhin enthalten ist. Und das, obwohl das von der Asylagentur der Europäischen Union zur Verfügung gestellte Informationsblatt über das Herkunftsland zeigt, dass Nigeria offensichtlich nicht sicher ist. AGOSTINA PIRRELLO erläutert das mangelhafte Verfahren für SCO-Bestimmungen und wie die Mitgliedstaaten die Rolle und das Fachwissen der EUAA (miss)brauchen können.
Das KlimaSeniorinnen-Urteil des EGMR ist bei uns in einem gemeinsamen Symposium mit dem Sabin Center bereits intensiv debattiert worden. JANINE PRANTL richtet den Blick auf einen weiteren Klima–Fall, der am EGMR anhängig ist und argumentiert, dass der österreichische Fall “Mex M.” zum ersten Klima-Fall vor dem EGMR werden könnte, in dem ein individueller Kläger die Hürde der Opfereigenschaft überspringen könnte.
Der US-Kongress hat ein Verbot von TikTok beschlossen. Damit soll es in den USA nunmehr zwei Standards bei Plattformregulierungen geben: Sehr liberale als Normalfall, und strenge in Zusammenhang mit sog. Foreign Adversary Countries. URS SAXER und ROMAN KOLLENBERG zeigen, welche grundlegenden Fragen diese Doppelstandards aufwerfen.
++++++++++Anzeige++++++++
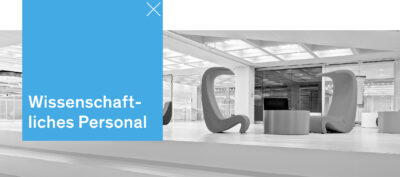

12 wiss. Mitarbeiter*innen (Praedoc) (Teilzeit 60 %, E 13 TV-L) Kennz. 2024/119. Die Stellen sind zum 01.10.24 zu besetzen und bis 30.09.28 befristet. Die Stellen sind am DFG-Graduiertenkolleg, Fachbereich LKM, angesiedelt. Während des laufenden Semesters wird die Präsenz der Kollegiat*innen vor Ort erwartet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sowie einer ca. 10-seitigen Skizze eines an das Graduiertenkolleg inhaltlich anschließbaren Promotionsprojekts bis zum 30.06.24.
Die Stellenausschreibung finden Sie hier. Hier geht es zum Bewerbungsportal.
++++++++++++++++++++++++
Ein Jubiläumsbeitrag in unserem Blogsymposium “Outstanding Women of International, European and Constitutional Law” anlässlich der 75. Jahre Grundgesetz von VERENA KAHL und FRANZISKA BACHMANN porträtiert Elisabeth Selbert, eine der vier “Mütter des Grundgesetzes”.
Der Seegerichtshof und der Klimawandel: Ein neues Blog-Symposium mit dem Sabin Center der Columbia University
Am 21. Mai 2024 hat der Internationale Seegerichtshof (ITLOS) ein lang erwartetes Gutachten zu Klimawandel und Völkerrecht veröffentlicht. Damit hat zum ersten Mal ein internationales Tribunal ein Gutachten zu den völkerrechtlichen Verpflichtungen von Staaten in Bezug auf Maßnahmen zur Verhinderung des Klimawandels vorgelegt. Es geht um Schlüsselfragen zur Anwendung des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS) im Kontext des Klimawandels, einschließlich der Interaktion zwischen UNCLOS und dem globalen Klimaschutzregime sowie den spezifischen Verpflichtungen der Staaten zur Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen.
Es gibt also viel zu besprechen – und das tun wir auch in einem gemeinsamen Blog Symposium mit dem Sabin Center for Climate Change Law. MAXIM BÖNNEMANN und KOREY SILVERMAN-ROATI leiten in das Symposium ein und zeigen was im Gutachten steht. JACQUELINE PEEL entnimmt dem Gutachten eine holistische Vision internationalen Klimarechts. Viele weitere Texte führender Völkerrechtler:innen folgen in den nächsten zwei Wochen.
*
Das wär’s für diese Woche! Ihnen alles Gute,
Ihr
Verfassungsblog-Editorial-Team
Wenn Sie das wöchentliche Editorial als Email zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.



