Tatsächliche Gleichberechtigung statt Blumen
1910 beschloss die II. Sozialistische Frauenkonferenz in Kopenhagen auf Antrag von Clara Zetkin und Käte Duncker, jedes Jahr einen Internationalen Frauentag durchzuführen, „der in erster Linie der Agitation für das Frauenwahlrecht dient“. Als Termin wurde auf Betreiben kommunistischer Frauen der 8. März festgelegt, um jener streikenden Frauen zu gedenken, die 1917 in St. Petersburg die russische Februarrevolution ausgelöst hatten. Die Weimarer Republik brachte 1918 endlich das allgemeine Wahlrecht auch für Frauen. Die politischen Forderungen am Internationalen Frauentag verlagerten sich deshalb auf bessere Arbeitsbedingungen für Frauen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, Gleichberechtigung in Partnerschaft und Familie sowie den Kampf gegen § 218 StGB, der seit der Kaiserzeit Abtreibung kriminalisierte. Die Nationalsozialisten verboten den Internationalen Frauentag und erhoben den Muttertag, von Blumenhändlern unterstützt, zum „Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter“. Davon erholt sich die deutsche Gesellschaft bis heute.
Unzweifelhaft ist die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in vielen Staaten der Welt wesentlich vorangekommen seit 1910, besonders in Demokratien. Warum sollte also nach 114 Jahren noch immer der Internationale Frauentag gefeiert werden, und warum in Deutschland? Zwar ist das allgemeine Wahlrecht für Frauen in europäischen Demokratien inzwischen unbestritten. Doch paritätische Repräsentation von Frauen in Parlamenten, hohen und höchsten Regierungsämtern oder den Spitzenpositionen in der Justiz und in der Wirtschaft ist in Deutschland längst nicht erreicht. Vor wenigen Tagen wurde erstmals in seiner siebzigjährigen Geschichte mit Dr. Christine Fuchsloch eine Frau zur Präsidentin des Bundessozialgerichts ernannt. Im Jahr 2024 ist die Forderung nach „Frauen in die Rote Roben“ noch immer erstaunlich aktuell und notwendig.
Heute kämpfen Frauen gegen gender care gap, gender pay gap (das mit der „Bereinigung“ ist übrigens selbst kompliziertund kommt nicht ohne gender bias aus), digital gender gap, gender data bias, gender lifetime earnings gap, gender pension gap – gaps, Lücken also, wohin das Auge blickt. Und das ist ein Grund, warum der Internationale Frauentag weiterhin wichtig ist.
Hinzukommen jene Kämpfe, die schon 1910 aktuell waren und es noch immer sind. Einen Überblick über die aktuellen Kämpfe geben die fundierten Stellungnahmen des Deutschen Juristinnenbundes (djb), der als überparteilicher Verband seit 75 Jahren feministische Forderungen beharrlich in die rechtspolitischen Diskussionen einbringt. Ich greife drei aktuelle Themen heraus: reproduktive Autonomie, körperliche Unversehrtheit und Gleichberechtigung im Arbeitsleben.
++++++++++Anzeige++++++++

re:constitution invites applications for Fellowships 2024/2025! Are you an early-career expert in academia or practice who needs time to think and reflect on a project related to democracy and the rule of law in Europe? Then explore the re:constitution Fellowships offering mobility across Europe, interdisciplinary debate and learning. Track 1 is open to academics and practitioners, while Track 2 directly addresses applicants working in practical environments due to its flexible design.
Please click here for more information.
++++++++++++++++++++++++
Reproduktive Autonomie
Der Kampf für reproduktive Autonomie und die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ist ein feministischer Dauerbrenner. „Weg mit § 218 StGB!“ war eine Forderung bereits der kaiserzeitlichen Feministinnen seit 1871. Dass wir in Deutschland über 150 Jahre später immer noch mit dieser Strafrechtsnorm zu tun haben würden, war nicht zu erwarten. In den USA droht aktuell die Verwirklichung des dystopischen Romans „Der Report der Magd“ von Margaret Atwood, in dem eine theokratische Männerdiktatur Frauen zum Gebären zwingt. „Reproduktive Autonomie“ ist ein weltweites (Verfassungsrechts)Thema. Hoffnungsfroh stimmt, dass Frankreich diese Woche das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert hat. Das wäre ohne die mutige Kämpferin Simone Veil nicht möglich gewesen, die 1974 erstmals dieses Recht mit der „Loi Veil“ politisch durchgesetzt hatte. Zu welchen Ergebnissen wird die Kommission der Bundesregierung gelangen, die derzeit prüft, wie sich der Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuchs regeln ließe? Ein mit nur einer Frau besetzter Zweiter Senat des Bundesverfassungsgerichts hatte 1993 allerhand Vorgaben aus dem Grundgesetz abgeleitet, bis hin zur fachlichen Qualifikation für die Beratung (Rn. 237 ff.). Wird in Deutschland endlich Schluss sein mit der krassen Bevormundung von Frauen durch die verpflichtende Zwangsberatung, die sie als unmündige Personen behandelt? Von einer Frau im Jahre 2024 gelesen erzürnt die Zweite Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch ganz außerordentlich, und es ist ungeheuerlich, dass dieses paternalistische, sexistische und bevormundende Konzept noch heute gelten soll. Und das ist ein Grund, warum der Internationale Frauentag weiterhin wichtig ist.
Femizide und sexualisierte Gewalt
Täglich werden in Europa zwischen 6 und 7 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet, in Deutschland fast jeden dritten Tag eine (Femizide). Jedes Jahr werden in der EU circa 1,5 Millionen Frauen vergewaltigt. Wer eine auch literarisch eindrückliche Schilderung typischer Gewaltdelikte im Nahbereich lesen möchte, dem seien die Bücher von Christina Clemm ans Herz gelegt, „Akteneinsicht“ (2020) und „Gegen Frauenhass“ (2023). Gleichwohl blockierte Bundesjustizminister Buschmann unlängst eine einheitliche europäische Definition des Vergewaltigungsstraftatbestandes in der EU-Richtlinie zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt, weil Einvernehmlichkeit zur Bedingung von Geschlechtsverkehr gemacht werden soll. Das ist der Unterschied zwischen dem in Deutschland seit 2016 geltenden Prinzip „Nein heißt nein“ (gegen den erkennbaren Willen) und dem autonomiewahrenden Prinzip „Ja heißt ja“ (mit freiwilligem Einverständnis), das die Istanbul-Konvention völkerrechtlich bindend vorgibt. Ein überzeugender Grund für diese Blockadehaltung ist nicht ersichtlich. Noch 2010 meinte ein ehemaliger Berliner Generalsstaatsanwalt, hätte er eine Tochter, würde er ihr abraten, eine Vergewaltigung anzuzeigen. Frauen bleiben weitgehend schutzlos gestellt, es herrschen weiterhin Mythen über Vergewaltigungen in der Strafjustiz (vor allem Täter-Opfer-Umkehr à la „sie hat sich nicht gewehrt“, „sie war leichtsinnig“, „sie war aufreizend angezogen“). Sexualisierte Gewalt muss effektiv verfolgt, Femizide müssen verhindert werden. Und das ist ein Grund, warum der Internationale Frauentag weiterhin wichtig ist.
++++++++++Anzeige++++++++

Der Lehrstuhl Kritik des Rechts (Prof. Dr. Felix Hanschmann, Bucerius Law School) und das Fachgebiet Just Transitions (Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano, Universität Kassel) laden zu der Fachtagung “Kritik und Reform des Jurastudiums” am 8. und 9. April in Hamburg ein. Gemeinsam wollen wir ausloten, wie die juristische Ausbildung an die gesellschaftlichen und studentischen Erfordernisse herangeführt werden kann.
Details zum Programm und zur Anmeldung finden Sie hier – wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, spannende Diskussionen und neue Impulse!
++++++++++++++++++++++++
Equal Pay
Vom gender pay gap war schon die Rede. Bereits im Parlamentarischen Rat hatte die Delegierte Helene Weber (CDU), eine von nur vier Frauen unter den insgesamt 77 Abgeordneten der verfassunggebenden Versammlung, eine Normierung der Entgeltgleichheit gefordert: „Männer und Frauen stehen bei Wahl und Ausübung des Berufes gleich, verrichten sie gleiche Arbeit, so haben sie Anspruch auf gleiche Entlohnung.“ Darauf wurde als allgemeine Auffassung von den männlichen Abgeordneten verkündet, dieser Grundsatz sei schon in der allgemeinen Formulierung enthalten, „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“. Der Parlamentarische Rat hielt also den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ für ein verfassungsrechtliches Gebot. Vor diesem Hintergrund erstaunt es, wie wenig die Entgeltgleichheit bislang rechtlich sichergestellt ist. Das „Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern“ von 2017 ist ein zahnloser Papiertiger geblieben. Mehr Hoffnung ruht jetzt auf der EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die Deutschland umsetzen muss. Hier gilt es, den Druck hochzuhalten, um tatsächliche Veränderungen zu erreichen und uns 75 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes dem Zustand anzunähern, den die Abgeordneten im Parlamentarischen Rat bereits für selbstverständlich hielten. Und das ist ein Grund, warum der Internationale Frauentag weiterhin wichtig ist.
Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung!
Formal gewährte Gleichheit tatsächlich zu erfüllen ist keineswegs ein Selbstläufer, sondern muss nach wie vor mühsam in einzelnen Themen und in Einzelfällen erstritten werden. Nicht selten müssen wir das Erreichte gegen Angriffe verteidigen. Rückschritte sind möglich und werden von manchen politisch erstrebt, die auch sonst einen Rückfall in braune Zeiten anstreben. Die Verbindung von rechtsextremen Gesinnungen und Frauenfeindlichkeit ist klassisch. Die bunten Demonstrationen der letzten Wochen sind deswegen ein ermutigendes Zeichen für Frauen und für die Demokratie ganz allgemein. Diese Form von Solidarität ist in einer Demokratie unerlässlich. Wenn Einzelne diskriminiert und ausgegrenzt werden, so setzt sich die Demokratie in Widerspruch zu ihrem eigenen Gleichheitsversprechen. Dieses Versprechen steht nicht nur auf dem Papier, sondern hat eine tatsächliche Dimension.
Soziale und rechtliche Kämpfe gegen Diskriminierung verlaufen in historischer Perspektive in drei Phasen: Rechte werden verwehrt, Rechte werden gewährt, tatsächlich gleiche Rechte müssen schließlich noch durchgesetzt werden. Elisabeth Selbert erkämpfte 1948/49 im Parlamentarischen Rat Art. 3 Abs. 2 GG: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Nach der Wiedervereinigung fügten 1993 kämpferische Frauen einen zweiten Satz hinzu: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Seither betont unsere Verfassung: Das mit der Gleichberechtigung der Frauen ist keine Verfassungslyrik. Wir als Demokratie meinen es damit ernst! Um uns an dieses Verfassungsgebot zu erinnern, feiern wir einmal im Jahr den Internationalen Frauentag – es sollte wie in Berlin ein Feiertag sein, damit wir auch Zeit haben zu demonstrieren! Und wir stehen solidarisch mit den Frauen in der ganzen Welt, die noch immer für Gleichberechtigung kämpfen! Diese Kämpfe sind leider im Jahr 2024 längst noch nicht vorbei. Und das ist ein Grund, warum der Internationale Frauentag weiterhin wichtig ist.
*
Die Woche auf dem Verfassungsblog
Dieser Montag war historisch. Der US Supreme Court hat – einstimmig – Donald Trump als Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl im November bestätigt. Einen Kandidaten zu disqualifizieren, der solide in den meisten Umfragen führt, wäre zweifelsohne komplex, fragwürdig und historisch ziemlich einmalig gewesen. Ebenso historisch einmalig sind jedoch die von Trump ausgehenden Gefahren für die amerikanische Demokratie und die bestehende Weltordnung (oder das, was von ihr übrig ist). MARK GRABER hat dies eindrücklich aufgearbeitet.
Wie lässt sich vermeiden, dass der Thüringer Verfassungsgerichtshof beschlussunfähig wird? Ein Vorschlag: Das Gericht könnte Personal selbst ergänzen, falls die Wahl neuer Verfassungsrichter*innen dauerhaft blockiert wird. WERNER REUTTER spielt die Idee in verschiedenen Szenarien durch.
Ein anderes Szenario eröffnen THOMAS BRITZ und BIJAN MOINI: Wenn die AfD eine Mehrheit im Thüringer Landtag hätte, könnte sie die Aufhebung bzw. Nichtaufhebung der Abgeordnetenimmunität gezielt einsetzen – für sich und gegen politische Gegner:innen. Die Autoren halten die Vorschriften für nicht zeitgemäß und schlagen vor, ein justiziables Willkürverbot als Reform einzuführen.
JULIAN SEIDL setzt sich kritisch mit den Bezahlkarten auseinander, die Asylbewerber künftig anstelle von Bargeld erhalten sollen. Er sieht das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums bedroht, weil einige der in den Ländern geplanten Modelle Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts unterschreiten.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will die allgemeine Wehrpflicht wieder einführen, nach schwedischem Vorbild auch für Frauen. KATHRIN GROH hat das grundrechtlich analysiert und stellt fest: Ein solches Wehrpflichtmodell wäre grundsätzlich machbar, allerdings nur mit einigen Verfassungsänderungen.
++++++++++Anzeige++++++++
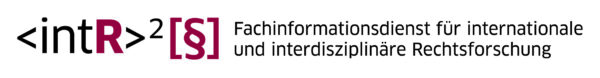
Der Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung hat den Virtuellen Lesesaal seiner Virtuellen Fachbibliothek um weitere e-Ressourcen aufgestockt – diese sind für die Rechtswissenschaft an Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland kostenfrei und überregional zugänglich –, u. a. um
- Cambridge University Press / Law e-Book Collection
- Dalloz.fr (schon vorher verfügbar), jetzt inkl. e-Books
- Duncker & Humblot / Schriftenreihe “Strafrecht und Kriminologie (SK)”
- Lexis360.fr (in Kürze verfügbar)
- Max Planck Encyclopedia of Public International Law – MPEPIL
- Oxford Reports on International Law – ORIL
++++++++++++++++++++++++
Eine Reform zur Entlastung des EuGH und für mehr Transparenz – das ist mit wachsender Bedeutung des Unionsrechts und einer steigenden Anzahl an Verfahren zu begrüßen. KATIA HAMANN hat sich die geplanten Änderungen angesehen und zweifelt, ob sie eine langfristige Entlastung des EuGH herbeiführen können.
Der Weg ist frei für eine Zwei-Prozent-Hürde bei Europa-Wahlen – zumindest vonseiten des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht habe das “Gebot der Stunde” erkannt und ist von seiner alten Darstellung des Europäischen Parlaments abgerückt, kommentieren JONAS GRUNDMANN und JOHANNA MITTROP in ihrer Entscheidungsbesprechung.
Angesichts der Nachrichten aus Gaza bahnt sich eine Debatte zur Legalität europäischer Rüstungsexporte nach Israel (und andernorts) an. Jüngst untersagte beispielsweise ein niederländisches Gericht den Export von Ersatzteilen von F-35 Kampfjets nach Israel. GALINA CORNELISSE beleuchtet die völkerrechtlichen Hintergründe.
KARIN DE VRIES hebt hervor, wie der EGMR im jüngsten Fall Wa Baile c. Suisse den Kampf gegen Racial Profiling intensiviert hat. Das Gericht kehrte die Beweislast um und akzeptierte, dass sowohl das Fehlen eines angemessenen präventiven Rahmens als auch Berichte internationaler Menschenrechtsorganisationen und NGOs dazu beitragen, eine vermutete Diskriminierung zu begründen.
Nach den ersten hundert Tagen der neuen Regierung in der Slowakei analysiert PETER ČUROS die paradigmatische Veränderungen in den Strafgesetzbüchern, die Angriffe auf zivilgesellschaftliche Organisationen, die Abschaffung des Sonderstaatsanwaltsamtes, einen Gesetzesentwurf zur Einschränkung des Whistleblower Schutzes und die Politisierung unabhängiger Institutionen. Er argumentiert, dass man einen radikalen Wandel im demokratischen Charakter der Slowakei und ihrer Position in den internationalen Beziehungen erwarten kann.
CLARISSE IKEDA LARCHER analysiert das Zentrum des Angriffs auf die tunesische Justiz durch Präsident Kais Saied, das Präsidialdekret 2022-35, im Licht internationaler Standards zur richterlichen Unabhängigkeit. Sie zeigt auf, wie die Situation in Tunesien ein drastisches Beispiel für die offensichtliche Übergriffigkeit der Exekutive im Bereich der Justiz darstellt.
++++++++++Anzeige++++++++

In einer Kooperationsveranstaltung mit der GEW Thüringen gehen wir Szenarien und Strategien für den autoritär-populistischen Ernstfall in Schulen auf den Grund. In dem Workshop werden die Ergebnisse der Recherche des Thüringen-Projekts präsentiert und gemeinsam mit der Seminargruppe Möglichkeiten erarbeitet, Schulen und Lehrkräfte für politische Vereinnahmungsstrategien zu sensibilisieren und Resilienz aufzubauen. Hier geht es zur Anmeldung für die Termine im Mai und Juni 2024.
++++++++++++++++++++++++
Wir freuen uns, diese Woche pünktlich zum “International Women’s Day” einen weiteren Beitrag in der Reihe “Outstanding Women of International, European and Constitutional Law” von Studierenden der Uni Hamburg zu veröffentlichen. FRANZISKA BACHMANN stellt in ihrem Portrait die, auch aus heutiger Sicht herausragende, Juristin Hélène Cazes Benatar vor.
GIACOMO MENEGUS befasst sich mit den zunehmenden repressiven Maßnahmen italienischer Behörden als Antwort auf die Klimaproteste in Italien. Der Beitrag gehört zum Symposium “Kleben und Haften: Ziviler Ungehorsam in der Klimakrise”.
Für das Symposium “Rethinking the Law and Politics of Migration” schreibt DANA SCHMALZ über die Rolle von Zahlen in der Migrationsdebatte. ANUSCHEH FARAHAT ermutigt uns abschließend, das Migrationsrecht und die Menschenrechte als eine Linse und ein Instrument zu betrachten, durch die die europäische politische Gemeinschaft und das normative Projekt, für das sie steht, gestärkt werden können.
Außerdem hatten wir noch einen Nachzügler zu unserem jüngsten Plattformregulierungssymposium. NATALI HELBERGER und PAMELA SAMUELSON analysierten, inwieweit der Digital Services Act ein global wirkendes Transparenzregime aufstellt.
*
Das wär’s für diese Woche! Ihnen alles Gute,
Ihr
Verfassungsblog-Editorial-Team




Um ein ebenfalls oft beleuchtetes Thema in diesem Bereich aufzugreifen – Frauen in der Wissenschaft hätten es vermutlich einfacher gehabt, wenn sie mehr Wissenschaft betrieben hätten als über Frauen in der Wissenschaft zu sprechen.
Wir bräuchten mehr Ruth Barcan Marcus und weniger Simone De Beauvoir, mehr GEM Anscombe und weniger Judith Butler. Irgendwo standen sich Frauen zumindest in geisteswissenschaftlichen Bereichen häufig im Weg, weil die bekanntesten Frauen in diesem Bereich ihr Ouevre auf Frauen fokussiert haben. Daran scheint sich in den vergangenen Jahren ebenfalls nicht viel verändert zu haben, was bedauerlich und auch nicht unbedingt emanzipatorisch förderlich ist.
Beizupflichten ist der Autorin in dem Befund, dass der internationale Frauentag angesichts – leider – weiterhin vielfältiger Herausforderungen für tatsächliche Gleichberechtigung große Bedeutung hat.
Mit derart pauschaler und unbegründeter Richterschelte wie die Autorin es jedoch gegenüber dem US-amerikanischem Supreme Court oder dem BVerfG in seiner zweiten Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch betreibt erweist sie diesem Anliegen einen Bärendienst.
Ihre Unterstellung, dass Schwangerschaftsabbruch II sexistisch sei und darüber hinaus auch nur deswegen so entschieden worden wäre, da lediglich eine Frau dem Spruchkörper angehörte, ist bereits vor dem Hintergrund abewegig, dass ebendiese Richterin (BVRin a.D Prof. Dr. Graßhof) mit der Mehrheit die Entscheidung mittrug (vgl. https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv088203.html). Außerdem zweifelt sie damit an, dass ein Richter auch in der Lage sein muss, sich in Fälle und Personen hineinzuversetzen, denen er nicht gleicht. Sollen daher folgerichtig nur noch Frauen über “weibliche” Themen und Männer über “männliche” urteilen?
Im Übrigen zeigt auch die Autorin keineswegs auf, ob und auf welche Weise ungeborenes Leben geschützt werden könnte statt durch eine Beratung, die ohnehin als reine Verfahrensvorgabe die Entscheidungsfindung der Schwangeren allenfalls beeinflussen, ihr aber keine konkrete Entscheidung aufzwingen kann. Wie dem staatlichen Schutzauftrag für das (werdende) Leben Genüge getan werden soll erörtert die Verfasserin nicht; es scheint ihrer Auffassung nach vollends hinter (ungrenzte?) reproduktive Rechte der Frau zu treten. Praktische Konkordanz scheint unerheblich zu sein, wenn sie nicht ins eigene Weltbild passt.
Auch die Annahme, dass infolge der Aufhebung von Roe vs. Wade in den USA ein Szenario wie in “The Handmaid’s Tale” drohe ist in Gänze absurd. Der US-amerikanische Supreme Court hat schlicht eine staatsorganisationsrechtliche Entscheidung getroffen, indem er konstantierte, dass die Herleitung eines Rechts auf Schwangerschaftsabbruch, welche durch Roe vs. Wade erfolgte, auf keiner tragfähigen verfassungsrechtlichen Grundlage beruhte. Dazu, ob Schwangerschaftsabbrüche von Verfassungs wegen erlaubt oder verboten seien machte das Gericht keinerlei Ausführungen und wies die Entscheidung dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber zu. Selbst Ikonen der feministischen Richterschaft wie Ruth Bader Ginsburg kritisierten Roe vs. Wade als dogmatisch weit hergeholt (https://www.washingtonpost.com/history/2022/05/06/ruth-bader-ginsburg-roe-wade/). Dass vor diesem Hintergrund der Supreme Court eine verfassungsrechtlich zumindest fragwürdige Entscheidung aufhebt und den Ball wieder in das Feld des (ggfs. auch verfassungsändernden) Gesetzgebers spielt, lässt sich sicherlich keinesfalls mit einer totalen Unterjochung und Degradierung der Frau wie im dystopischen Szenario der “Mägde” vergleichen.
Im Übrigen zeigt dabei auch das Wahlvolk in konservativen Staaten wie Kansas (https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kansas-stimmt-fuer-recht-auf-abtreibung-us-staat-gilt-als-konservativ-18217691.html), dass die Sicherung reproduktiver Rechte in verfassungskonformer Weise möglich ist – wenn man denn auf die demokratische Gestaltungskraft des Volkes als Souverän vertraut und sich nicht stattdessen auf juristisch fragwürdige Auslegungen um die Erreichung feministischer Ziele willens verlässt.
Selbstverständlich kann und soll ein Editorial oder ein Kommentar auch mal scharf oder überspitzt formuliert sein. Eine derartige Verkürzung wie hier ist jedoch einer Juristin von der Argumentationsstärke wie derjenigen der Verfasserin unwürdig. Statt daher Maximalforderungen zu vertreten, dürfte es um der Gleichberechtigung willen sinnvoller sein, RBGs Rat zu folgen und den Wandel schrittweise in Kompromissen zu gestalten. Ob hierzu die Autorin und ihrer Anhänger(innen) bereit sind erscheint mehr als zweifelhaft. Schade.
Dass der Weltfrauentag immer noch oder vielleicht leider auch schon wieder wichtig ist, steht außer Frage.
Die dafür ins Feld geführten “Argumente” überzeugen mich einfach nicht. Anstatt in den § 218 StGB bevormundung hineinzuinterpretieren, wäre es sinnvoller, eine flächendeckende Beratung und die Durchführung des dazugehörigen Eingriffs in die medizinische Ausbildung zu fordern. Dann wäre vielleicht auf tatsächlicher Ebene gewährleistet, die Entscheidung auch umzusetzen, ohne dafür kilometerweit durch die Repuplik fahren zu müssen. Aber das wäre ja reale Problemlösung, statt theoretischer Verbesserung. Mit ersterem haben wir es ja häufig nicht so.
Bei dem Begriff Femizid schalte ich ehrlicherweise ab. Er wird so gut wie nie im richtigen Kontext gebraucht. Der Begriff Femizid wurde von Diana E. H. Russell, einer feministischen Aktivistin und Soziologin, entwickelt. Sie definierte Femizid wie folgt: „Die Tötung einer oder mehrerer Frauen durch einen oder mehrere Männer, weil sie Frauen sind“. Wenn mich mein (Ex-)Partner tötet, weil er nicht damit umgehen kann, dass ich ihn verlassen habe. Dann tötet er mich nicht, weil ich *eine* Frau. Dann tötet er mich, weil das sein gefühl von Ehre verletzt oder er krankhaft eifersüchtig ist. Würde er mich töten, weil ich eine Frau bin, hätte es diesen Anlass nicht gebraucht. Auch hier wird anstelle praktikabler Lösungen zu finden, lieber an der sprachlichen Darstellung gewerkelt.
Wo kommt eigentlich die Idee her, dass mehr Transparenz das zu Grunde liegende problem behebt? Sollte nicht die Erfahrung mit dem Internet als unbegrenzter Wissenszugang deutlich gemacht haben, dass mehr zu wissen, nicht automatisch Probleme behebt? Je mehr Einzelheiten es zu wissen gibt, je kmplexer wird es, diese zu interpretieren und daraus richtige Schlüsse zu ziehen. Qualität schlägt auch hier Quantität. Aber auch hier ist es ja viel einfacher mit solchen Nebelkerzen zu hantieren, statt echte Lösungen zu entwickeln.
Ich als Frau, bin von der Art und Weise, wie gerade im akademischen Kontext über Frauenrechte diskutiert wird, einfach kolossal genervt. Mit Lösungsorientierung hat das zu selten was zu tun. Aber die braucht es, um tatsächlich was an den Situationen zu verändern.