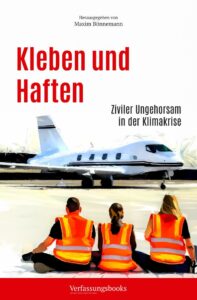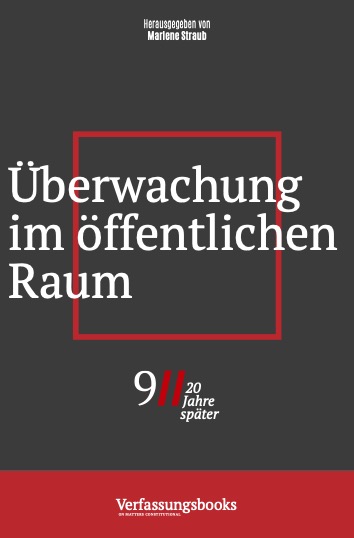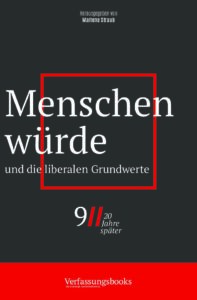Nils Lund
In seinem Beitrag vom 13. August beleuchtet Thomas Groß die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Sitzblockaden und ihre Bedeutung für die Bewertung von Protestaktionen der Letzten Generation. Es widerspräche der Normhierarchie, wenn der einfache Gesetzgeber berechtigt wäre, als „friedlich“ qualifiziertes Verhalten mit dem entgegengesetzten Begriff der „Gewalt“ zu belegen. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Rechtsprechung der Karlsruher Richterinnen und Richter seit Jahrzehnten von der Einsicht geprägt ist, dass eine Versammlung, die nach strafrechtlichen Maßstäben Gewalt ausübt, nicht zwangsläufig unfriedlich i.S.d. Art. 8 Abs. 1 GG ist.
Continue reading >>
Thomas Groß
Es widerspräche der Normhierarchie, wenn der einfache Gesetzgeber berechtigt wäre, ein verfassungsrechtlich als „friedlich“ qualifiziertes Verhalten mit dem entgegengesetzten Begriff der „Gewalt“ zu belegen. Wenn „Gewalttätigkeiten“ charakteristisch für die Unfriedlichkeit einer Versammlung sind, dann kann eine friedliche Versammlung nicht umgekehrt als „Gewalt“ qualifiziert werden.
Continue reading >>
Giacomo Menegus
As climate protests are mounting across Italy, there is a corresponding escalation in repressive responses from public authorities. This trend is not unique to Italy but is rather widespread throughout Europe, as evidenced by frequent reports in national newspapers and posts on this blog. What sets Italy apart from other European nations is the spectacular increase in the use of preventive measures by the public security administration.
Continue reading >>
Liz Hicks
This post considers the latest episode of Australia’s engagement with civil disobedience under its constitutionally ‘implied freedom of political communication’ — Kvelde v New South Wales (‘Kvelde’). In Kvelde a judge of the New South Wales Supreme Court followed the tendency of some High Court judges of reducing the democratic value of civil disobedience to binary terms: if a form of political speech is already illegal, the Court will not engage with further legislative acts seeking to increase penalties for it. I describe this as the ‘binary approach.’ I argue that the binary approach reflects a particular judicial theory of political change not necessarily prescribed by the freedom, that is also out of step with historical Australian political practices.
Continue reading >>
Philipp Schönberger, Katharina Naujoks
In der Diskussion über den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB) gegen die „Letzte Generation“ vertraten prominente Stimmen die Ansicht, der Straftatbestand setze seit einer Reform von 2017 keine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit mehr voraus. Diese Behauptung lässt sich zwar eindeutig widerlegen, hat aber dennoch für Verwirrung über Gültigkeit und Inhalt des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals gesorgt. Eine Auseinandersetzung mit dessen Anforderungen ist dringend erforderlich. Nicht nur die jüngsten Entwicklungen in den Verfahren gegen die „Letzte Generation“ machen die praktische Bedeutung einer vermeintlichen juristischen Feinheit deutlich. Die Frage der „Erheblichkeit“ ist darüber hinaus auch für die größere Frage relevant, wie eine liberale Demokratie mit disruptiven Klimaprotesten umgeht.
Continue reading >>
Matthias Jahn, Fynn Wenglarczyk
Die Debatte um den richtigen Umgang mit zivilem Klimaschutzungehorsam von Klima-Aktivistinnen und Klima-Aktivisten bleibt im Fluss. Sichtweisen, die auf Basta-Legalismus („Recht muss Recht bleiben“) hinauslaufen, verstellen den Blick auf die strafverfassungsrechtlichen Implikationen, die mit der Verfolgung organisierten Klimaprotests als organisierter Kriminalität durch Vereinigungen einhergehen. Der robusten Strafverfolgung organisierten Klimaprotests wegen Gründung oder Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung stehen in der Demokratietheorie wurzelnde Bedenken entgegen. Sie haben auf Ebene der Verhältnismäßigkeit staatlicher Reaktionen bislang noch keine ausreichende Beachtung gefunden.
Continue reading >>
Jevgeniy Bluwstein, Clémence Demay, Lucie Benoit
Since 2018, Swiss courts have become regular sites of criminal trials against climate activists who engage in various forms of non-violent protest to obtain effective climate action from their government and raise public awareness. Since the autumn of 2018, we have recorded approximately 30 non-violent forms of climate protest and civil disobedience across Switzerland, leading to at least 200 trials in Swiss criminal courts. In this contribution, we highlight three themes that have emerged in the trials of climate activists: First, the Federal Supreme Court has closed the door to the use of the necessity defense to justify civil disobedience in the name of the climate emergency. Second, at least some Swiss judges and courts are open to considering and applying the case law of the ECtHR. Third, the idea of civil disobedience remains deeply contested in the courts, as it is considered by the authorities to be antithetical to the Swiss model of democracy.
Continue reading >>
Adam Wagner
Disruptive environmental protest has become a hugely controversial issue in the UK, both politically and legally. It is likely to be a wedge issue in the upcoming General Election. Both major political parties are talking tough on the issue, and the government has instituted draconian new laws. The courts, for their part, are permitting ever more 'Mega Persons Unknown injunctions' and imposing increasingly longer prison terms for peaceful – but disruptive – protests. Part of this is an international trend, caused by the indisputable evidence of global warming and the increasingly activist environmental movement. But from a UK practitioner’s perspective, it is deeply worrying that there are now a large number of peaceful protesters in the prison system, or facing huge bills for legal costs, or both.
Continue reading >>
Liz Hicks
In Germany, disruptive protest demanding climate change mitigation policies has provoked popular and constitutional discussion. Commentators have questioned whether acts of illegality committed as civil disobedience should be treated distinctly from ‘ordinary’ criminality and punished more leniently. In other parts of the world, however, legislative activity has singled out the illegality involved in civil disobedience to the opposite end. Legislatures have introduced laws that radically increase penalties for existing offences involved in disruptive protest and blockades, conferred new powers on police, and created new offences for previously legal forms of protest. In this post I explore an Australian legislative trend of the last decade that specifically targets environmental civil disobedience by imposing additional criminal penalties upon its exercise. The Australian case study is a cautionary tale of what can follow a failure to recognise democratic value in civil disobedience and treat it with constitutional nuance.
Continue reading >>
Hannah Espín Grau, Tobias Singelnstein
Bereits seit längerer Zeit kommen in (Teilen) der Polizei Techniken der Gewaltanwendung zum Einsatz, die als Schmerzgriffe bezeichnet werden. In der englischsprachigen Debatte werden diese Techniken unter dem Schlagwort „pain compliance“ diskutiert, was deutlich macht: Durch Schmerzen soll Gehorsam durchgesetzt werden. Rechtlich stellen sich Schmerzgriffe als problematisch dar, da sie vor allem auf eine Willensbeugung der Betroffenen durch (Angst vor) Schmerz abzielen. Die polizeiliche Praxis überformt zudem die rechtlichen Vorgaben zur Anwendung von Schmerzgriffen zugunsten einer effizienten polizeilichen Einsatzdurchführung. Sozialwissenschaftlich bzw. kriminologisch können Schmerzgriffe daher als Normalisierung und Verselbständigung polizeilicher Gewaltpraxen verstanden werden.
Continue reading >>
Andreas Gutmann, Tore Vetter
Die Versammlungsfreiheit gerät unter Druck. Immer öfter versuchen staatliche Behörden in verblüffender Verkennung verfassungsrechtlicher Prinzipien dieses Grundrecht zu entkernen. Der neueste Akt dieser Entwicklung stammt aus Baden-Württemberg. Per Allgemeinverfügung vom 7.7.2023 verbietet die Stadt Stuttgart bis zum Ende des Jahres Blockadeaktionen der Klimabewegung, bei denen sich Aktivist*innen auf die Straße kleben oder anderweitig mit der Straße oder anderen Personen verbinden. Was zunächst als lokale Randnotiz erscheinen mag, erweist sich beim näheren Blick als Lehrstück eines sowohl zweck-, als auch rechtswidrigen Umgangs des Staates mit Klimaprotesten.
Continue reading >>
Stefan König
Um den Aktivist:innen der „Letzten Generation“ mit den Mitteln des Strafrechts zu Leibe zu rücken, schwingt die Generalstaatsanwaltschaft in München die große OK-Keule unter Einsatz des § 129 StGB. Die Staatsanwaltschaft Berlin scheint sich jetzt in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Sie greift in die strafprozessuale Mottenkiste und will das „beschleunigte Verfahren“ (§§ 417 ff. StPO) zum Einsatz bringen, ein zur Aburteilung Kleinkrimineller vorgesehenes Verfahren. Dazu sind Sonderabteilungen beim Amtsgericht Tiergarten geschaffen worden, die zur besonderen Verwendung durch die Staatsanwaltschaft Berlin eingerichtet sind. Das lässt den Eindruck von „Ausnahmegerichten“, eine Verletzung des Rechtes auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 GG) und eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit entstehen.
Continue reading >>
Lena Herbers
Spätestens seit dem Frühjahr 2022 ist ziviler Ungehorsam in Deutschland wieder in aller Munde. Die Justiz, Wissenschaft und die politische Öffentlichkeit sind durch die Protestaktionen insbesondere der „Letzten Generation“ mit dynamischen Entwicklungen konfrontiert. Immer im Raum, aber selten ausgesprochen, steht dabei die Kernfrage: Wann ist es gerechtfertigt, Gesetze zu brechen, um für ein höheres Ideal einzustehen? Ein Blick in die Geschichte sozialer Bewegungen zeigt: Dann, wenn es um existenzielle Krisen geht.
Continue reading >>
Andreas Nitschke
„Als Polizistin bei der Letzten Generation“ – so betitelte ZEIT Online gestern einen Bericht über eine Hauptkommissarin, die in ihrer Freizeit die Letzte Generation unterstützt. Der Fall sorgt für Aufsehen – und rückt eine Frage in den Mittelpunkt, die in der bisherigen Diskussion über die Letzte Generation bislang keine Beachtung gefunden hat: Dürfen sich Beamt:innen für diese Bewegung engagieren?
Continue reading >>
Fin-Jasper Langmack, Anna-Mira Brandau
Die Aktionen der „Letzten Generation“ haben den gesellschaftlichen und juristischen Diskurs der letzten Monate geprägt. So engagiert die juristische Diskussion jedoch geführt wird, so sehr verharrt sie ganz überwiegend noch im nationalen Recht. Die zuständigen deutschen Strafrichter:innen werden sich jedoch auch dem Blick nach Straßburg nicht entziehen können – die Blockadeaktionen der „Letzten Generation“ stehen unter dem Schutz der in Artikel 11 Abs. 1 EMRK kodifizierten Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Dieser Schutz steht einer strafrechtlichen Sanktionierung der Aktionen nicht grundsätzlich im Weg; eine Rückbesinnung auf die menschenrechtliche Dimension der Proteste kann und sollte aber ein Korrektiv für allzu ausgeartete Kriminalisierungs- bzw. Selbstjustizfantasien darstellen.
Continue reading >>
Felix Wirth Hanschmann
Die Aufregung in Medien und Politik war ebenso groß wie schnell verflogen. Vertreter*innen der "Letzten Generation vor den Kipppunkten", so wurde berichtet, wollten an Schulen aktiv werden und Schüler*innen für Aktionen mobilisieren. Zum Glück trafen sie damit aber auf den „klaren Widerstand“ der Kultusminister*innen, die sich mutig der „Rekrutierung“ entgegenstellen. In Hamburg forderte die CDU in der Bürgerschaft, dass den Schulen verboten wird, in irgendeiner Weise mit Aktivist*innen der Letzten Generation zusammenzuarbeiten. Sich pauschal gegen die Einladung von Vertreter*innen der „Letzten Generation“ auszusprechen verkennt gleichermaßen die Aufgaben von Schulen wie auch die rechtlichen Bedingungen für die Beteiligungsmöglichkeiten externer gesellschaftlicher Kräfte in der Schule.
Continue reading >>
Jochen von Bernstorff
Wegen der in vielen Staaten der Welt zunehmenden Repressionen gegenüber friedfertigen Protestbewegungen, die vor allem auf Sitzblockaden zurückgreifen, hatten der UN-Menschenrechtsausschuss und auch der UN-Sonderberichterstatter sich in den letzten beiden Jahren wiederholt zu den menschenrechtlichen Standards im Umgang mit störenden Protestformen geäußert. Die dort identifizierten Gefahren für das Menschenrecht auf Versammlungsfreiheit sind auch für die deutsche Situation aufschlussreich.
Continue reading >>
Samira Akbarian
Seit den Hausdurchsuchungen in 15 Wohnungen von Mitgliedern der „Letzten Generation“ hat sich die öffentliche Diskussion um die Aktionen der Gruppe noch einmal intensiviert. Im Zentrum steht dabei der Begriff des „Zivilen Ungehorsams“. Obwohl das dahinterstehende Konzept auf viel, auch auf viel berechtigte, Kritik stößt, möchte ich zeigen, dass „ungehorsames“ Protestverhalten die Funktion erfüllt, Ungleichgewichte in den Möglichkeiten politischer Einflussnahme auszugleichen. Ziviler Ungehorsam kann dabei eine integrative Funktion erfüllen; er kann aber auch die diskursiven Verhältnisse aufbrechen und zu gesellschaftlichen und politischen Veränderungen anstoßen. Zudem zeichnet er sich dadurch aus, dass er Visionen einer normativen Zukunft entwickelt und insofern einen Beitrag zur Entwicklung der politischen Gemeinschaft und ihrer Verfassung leistet. Die weltweit zunehmende Kriminalisierung von Protestaktionen missachtet diese demokratische und rechtsstaatliche Bedeutung zivilen Ungehorsams.
Continue reading >>
Klaus Ferdinand Gärditz
Die aus der Mottenkiste der politischen Theorie entliehene Figur des „zivilen Ungehorsams“ in ihrer schillernden Unbestimmtheit ist kein grundrechtsdogmatisch plausibles Argument. Es gibt keine habermaskonforme Auslegung des Grundgesetzes. Ein dysfunktionales Einsickern in das Vokabular der Verhältnismäßigkeit wäre folgenreich und hat das Potential, die Mechaniken angemessenen Interessenausgleichs auszuhebeln, auf den wir alle gerade dann angewiesen sind, wenn wir erfolgreich die Wende in die Klimaneutralität organisieren wollen. In Zeiten, in denen sich die Institutionen des liberal-demokratischen Rechtsstaats immer aggressiveren Anfechtungen ausgesetzt sehen und sich robust behaupten müssen, wird die durchsetzbare Verpflichtung aller Akteure auf die demokratische Legalität zu einem kostbaren Gut. Man sollte es keinem autoritären Illegalismus opfern.
Continue reading >>
Michael Kubiciel
Die Ermittlungen wegen § 129 StGB gegen die Letzte Generation haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt begonnen und stehen auf einer rechtlich alles andere als sicheren Grundlage. Die Strafverfolgungsbehörden manövrieren an der Grenze des Tatbestandes. Dies heißt aber auch, dass alle, die die Letzte Generation als Mitglied unterstützen, sich der Gefahr von Ermittlungsmaßnahmen aussetzen, also an der Grenze dessen agieren, was man sich selbst guten Gewissens zumuten möchte und kann. Schon die Ermittlungen wegen § 129 StGB haben damit eine prohibitive Wirkung.
Continue reading >>
Thorsten Koch
Der Anwendungsbereich von § 129 StGB wirft mehr Fragen auf, als er klare Antworten gibt; dabei kreist die strafrechtliche Diskussion erkennbar um das „Ob“ und „Wie“ der Begrenzung eines zu weit geratenen oder jedenfalls als zu weit empfundenen Tatbestands. Daraus resultiert offenbar auch, dass die Frage, inwieweit die Unterbrechung von Routinen und täglichen Abläufen durch Aktionen der „Letzten Generation“ sich unter diese Norm subsumieren lässt, allgemein als offen angesehen wird. Schon diese Gegebenheiten legen jedoch nahe, dass es geboten ist, den gordischen Knoten strafrechtsdogmatischer Erwägungen mit dem scharfen Schwert des Verfassungsrechts zu durchschneiden: § 129 StGB ist in seiner derzeitigen Form verfassungswidrig!
Continue reading >>
Katrin Höffler
… so lautet der Titel eines Aufsatzes von Habermas, erschienen 1983. Genau diesen Testfall erleben wir derzeit. Es scheint, als ob „der Rechtsstaat“ – nach Wochen des intensiven Protests durch die „Letzte Generation“ in Berlin – nun „andere Saiten aufziehen“ möchte, und erneut nach dem Strafrecht greift, genauer gesprochen nach einem Tatbestand des ohnehin nicht unproblematischen Präventivstrafrechts.
Meine These ist jedoch, dass der Versuch, die Klimaproteste „wegzustrafen“, den Rechtsstaat zwangsläufig schwächt, anstatt ihn zu stärken. Da politischer Protest im Ausgangspunkt als wesentliches Element einer demokratischen Kultur ausgehalten werden muss, ist auch der Umgang mit unter Umständen strafbaren Aktionen im Zuge des politischen Protests - freilich im Rahmen des Legalitätsprinzips - mit Augenmaß zu wählen, um diesen Grundsatz nicht zu konterkarieren.
Continue reading >>
Klaus Ferdinand Gärditz
Die freie öffentliche Auseinandersetzung über Ziele der Politik ist nur möglich, wenn sich diese auf kommunikative Mittel beschränkt und nicht Rechte anderer verletzt. Freiheit ist in einer Rechtsgemeinschaft immer konditioniert, auch die politische. Illegale Druckmittel und Emphasizer symbolisch einzusetzen, um dem eigenen Anliegen ersehnte schnelle Sichtbarkeit zu verschaffen, ist gerade ein Angriff auf die Kommunikationsstruktur des demokratischen Prozesses, der erst die politische Gestaltung des Miteinanders auf der Grundlage der gleichen Freiheit aller sichert. Die Selbstprivilegierung, sich kraft erfühlter höherer Einsicht oder aus narzisstischem Sendungsbewusstsein über die gleiche Freiheit der anderen zu stellen, die für ihre – zunächst einmal ebenfalls legitimen – Anliegen um Mehrheiten werben müssen, ist anti-demokratisch, anti-egalitär und letztlich autoritär. Weder Gesetzgeber noch Strafverfolgungsbehörden und Gerichte sind verfassungsrechtlich in der Pflicht, dies im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu honorieren.
Continue reading >>
Fynn Wenglarczyk
Mit den bundesweiten Hausdurchsuchungen gegen Mitglieder von „Letzte Generation“ erreicht der gesellschaftliche Konflikt um die Klima-Proteste nach der Verurteilung erster Aktivist*innen zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung die nächste Eskalationsstufe. Nicht mehr nur die Einzelaktionen werden als strafbares Verhalten delegitimiert, sondern die Klima-Gerechtigkeitsbewegung im Ganzen, soweit sie sich in Zusammenschlüssen organisiert, die auf zivilen Ungehorsam als Protestform setzen. Das „Feindbild Klimaaktivismus“, es nimmt mehr und mehr Kontur an.
Continue reading >>
Jana Wolf
Das Urteil des Amtsgerichts Flensburg zu Klimaschutz als rechtfertigendem Notstand stößt auf Begeisterung und scharfe Ablehnung. Nachdem der Freispruch eines Klimaaktivsten durch das Gericht bereits im November bekannt wurde, sind nun die Urteilsgründe veröffentlicht worden. Inmitten der zunehmend intensiver geführten Debatte um den juristisch „richtigen“ Umgang mit Klimaaktivismus schlägt das Urteil eine ebenso ungewohnte wie mutige Richtung ein.
Continue reading >>
Jan-Louis Wiedmann
Das Amtsgericht Flensburg hatte jüngst über die Strafbarkeit eines Klimaaktivisten zu entscheiden, der ein fremdes Grundstück unbefugt betreten hatte, um dort die Rodung eines kleinen Waldstücks zu verhindern. Der Aktivist wurde vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen, weil seine Tat dem Klimaschutz gedient habe und damit wegen Notstands (§ 34 StGB) gerechtfertigt sei. Dieser Beitrag wirft einen Blick auf die rechtliche Diskussion um Klimaproteste und um die diesbezüglichen Urteile und wirft dabei zwei Fragen auf: Sollten kleine Beiträge zum Klimaschutz als solche rechtlich anerkannt werden oder nicht? Und: Sind unkonventionelle Klima-Urteile illegitimer ‚richterlicher Aktivismus‘ oder ein Beitrag zur Rechtskultur? Bei beiden Fragen geht es um das Verhältnis vom Kleinen (Protestaktion, Urteil) zum Großen (Klimaschutz, Rechtskultur) und damit letztlich um das Verhältnis zwischen Baum und Wald.
Continue reading >>
Rouven Diekjobst
Bereits vor einigen Wochen wurde bekannt, dass das Amtsgericht Flensburg einen Klimaaktivisten freigesprochen hatte, der einen Baum auf einem Privatgrundstück besetzt hatte. Der Baum sollte auf Grundlage einer Baugenehmigung gerodet werden, gegen die auch eine verwaltungsgerichtliche Klage eingereicht worden war. Nun ist die Urteilbegründung veröffentlicht: Das Gericht sah § 123 StGB – Hausfriedensbruch – zwar tatbestandlich erfüllt, jedoch aufgrund von § 34 StGB in einer Art „Klimanotstand“ gerechtfertigt. Die vom Gericht bemühte „verfassungskonforme“ Auslegung ist jedoch weder überzeugend noch verallgemeinerungsfähig, schadet dem Ansehen der Judikative und schafft einen Anreiz für zukünftiges rechtswidriges Verhalten.
Continue reading >>
Ralf Poscher, Maja Werner
Die Proteste der Klimaschutzgruppe der „Letzten Generation“ sind momentan aufgrund ihrer gewählten Protestformen ein vieldiskutiertes Thema. Eine der umstrittenen Protestformen besteht darin, sich mit den Händen auf der Straße festzukleben. Nachdem Klimaaktivistinnen in München ihre Protestaktionen wiederholten, wurden sie in Gewahrsam genommen - mit einer angeordneten Gewahrsamsdauer von 30 Tagen. Die pauschale Ausschöpfung der Höchstgrenze des Gewahrsams im Fall des Vorgehens gegen Aktivistinnen der Münchener Klimaproteste ist von der – ohnehin rechtlich bedenklichen – Rechtsgrundlage im bayerischen Polizeigesetz nicht gedeckt.
Continue reading >>
Katrin Höffler
Derzeit erleben wir nahezu täglich und in ganz Europa, dass junge Menschen in unterschiedlichen Formen Protest erheben, um auf den voranschreitenden Klimawandel hinzuweisen. Alexander Dobrindt forderte härtere Strafen für „Klima-Chaoten“, um eine Radikalisierung zu vermeiden. Sollte der Protest besonders streng geahndet werden? Meine These lautet, dass selbst im Falle einer Strafbarkeit ein Labeling als Öko-Terrorismus beziehungsweise Schwerkriminalität nicht nur falsch, sondern sogar schädlich ist.
Continue reading >>
Tobias Gafus
Auf Welt.de ist vor kurzem ein Stück Service-Journalismus der besonderen Art erschienen. Der Redakteur Constantin van Lijnden hat die „Rechte der ausgebremsten Bürger“ zusammengetragen. Was kann man tun gegen die Störenfriede der Letzten Generation, die sich fortwährend auf Straßen festkleben, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen? Der Staat, jedenfalls in Berlin, leider nur wenig, so der Tenor.
Continue reading >>
Daria Bayer
Vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten finden zurzeit Prozesse gegen Aktivist:innen von Letzte Generation statt. Diese hatten sich an verschiedenen Straßen in Berlin festgeklebt, um auf die unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen aufmerksam zu machen (die BZ prägte deshalb auch den Begriff „Klima-Kleber“). Dadurch kam es teilweise zu Straßensperren und Staus. Die jüngst ergangenen Urteile werfen die Frage nach den strafrechtlichen Grenzen von zivilem Widerstand bzw. Ungehorsam auf: Kann Klimaschutz ein strafrechtlicher Rechtfertigungsgrund sein?
Continue reading >>